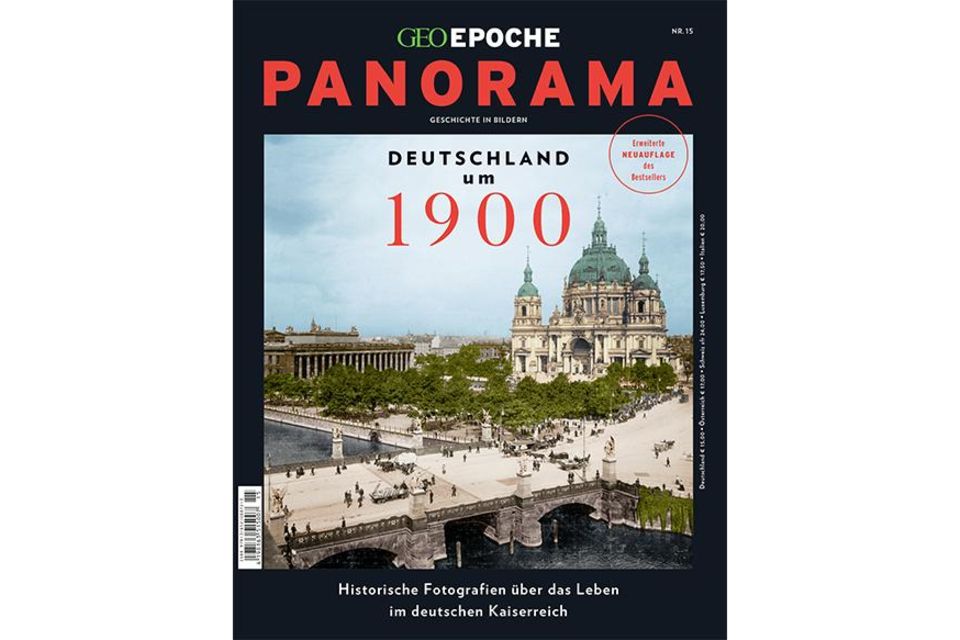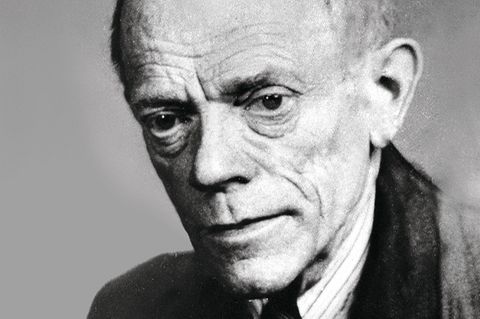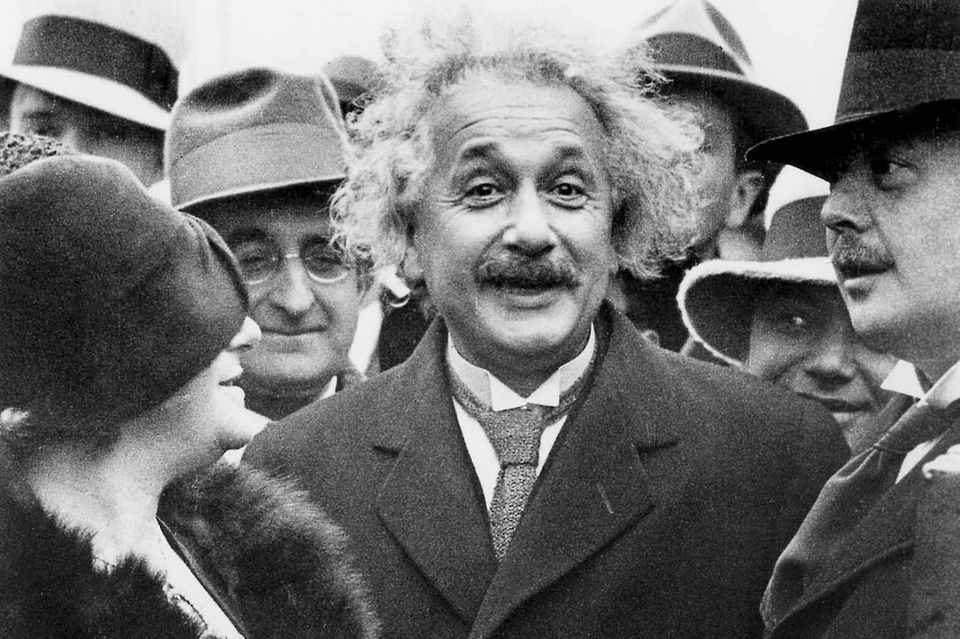Dies ist mehr als ein Abschied: Es ist ein Totenamt. Ein Kondolenzzug – mit Zehntausenden Trauernden, mit weinenden Hinterbliebenen, mit gezückten Taschentüchern, mit gelüfteten Hüten und stummem Hände drücken. Selbst die Kürassiere an der Spitze des Zugs haben Tränen in den Augen. Blüten regnen auf den Wagen herab, und vielstimmig steigt am Lehrter Bahnhof der Trostgesang empor: "Lieb Vaterland, magst ruhig sein".
Otto von Bismarck ist, wie eine Diplomatengattin feststellt, "totenbleich". Er selbst wird diesen 29. März 1890, an dem er auf sein Altenteil auf Gut Friedrichsruh bei Hamburg zurückkehrt, später ein "Begräbnis" nennen – ein "Leichenbegängnis erster Klasse".
Doch in Wahrheit ist seine Abreise aus Berlin der Übergang eines Lebenden ins Geisterreich; die Verwandlung eines Menschen in ein Denkmal. Sie macht den Unbeirrbaren zum Untoten, der fortan zwischen den Eichen, Buchen und Tannen des Sachsenwaldes acht Jahre lang jene Lebenden heimsuchen wird, die ihn in sein komfortables Grab gebracht haben.
1890 wurde Bismarck zum Rückzug aus der Politik gedrängt
Der politische Tod, der den Kanzler kurz vor seinem 75. Geburtstag ereilt hat, kam plötzlich, aber nicht unerwartet. Er begann mit der Thronbesteigung des 44 Jahre jüngeren Kaisers Wilhelm II. im Juni 1888 – jenes unberechenbaren, manischen Hitzkopfs, der sein Sohn sein könnte, aber alles Zeug zum Vatermörder hat. Gelang es Bismarck jahrzehntelang, seinen Herrscher zu beherrschen ("Es ist nicht leicht, unter einem solchen Kanzler Kaiser zu sein", soll Wilhelm I. geklagt haben), beharrt dieser Monarch auf seinem "persönlichen Regiment".
Der Starrsinn, mit dem Bismarck Ende 1889 das auch unter Konservativen umstrittene "Sozialistengesetz" auf unbestimmte Zeit verlängern wollte, war dann nur noch der Anlass: Am 17. März 1890 überbrachte der Chef des Militärkabinetts dem Kanzler die Aufforderung, sein Entlassungsgesuch zu verfassen. Am 20. März nahm der Kaiser es an. Dann feierte er mit Generälen bei Bier und Champagner.
Er ahnte nicht, dass der vermeintlich zur Ruhe Gelegte zum Wiedergänger werden würde. Zum "Weißen Mann", wie ihn schon bald sein wortmächtigster Verkünder, der Essayist Maximilian Harden, mit ehrfürchtigem Schauer rühmt – in Anspielung auf jene sagenhafte "Weiße Frau", die seit dem 15. Jahrhundert durch Hohenzollernschlösser spuken und Unheil ankündigen soll.
Bismarck sei nun, so Harden, ein "gewaltiges, alles überragendes Gespenst, dessen Erscheinen und Schwinden den für das deutsche Land wichtigsten Vorgang bedeutet und dessen Lebensregung der Kluge nie aus dem Auge verlieren darf: Ruht es, dann stockt auch der Zeiger der Schicksalsuhr auf seinem Stundenweg; schlürft es aus der düsteren Waldestiefe hervor, dann kündigt ein neues Wollen und Werden sich an."
Nach seinem politischen Tod meldet sich Otto von Bismarck unablässig zu Wort
Hardens spiritistische Metaphorik trifft den Nerv der Zeit. Denn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts überrollt eine Welle des Geisterglaubens die industrialisierte Welt: Seit im März 1848 eine Farmersfamilie im US-Bundesstaat New York angeblich per Klopfzeichen Kontakt mit dem Geist eines ermordeten Krämers aufgenommen hat ("Wir Toten leben und können wieder mit euch in Verbindung treten", lautete die Botschaft), treffen sich nicht nur in den USA, sondern auch in Europa ehrbare Bürger zum Tischerücken.
Längst sind es nicht mehr nur die Armen im Geiste, die auf die Stimmen von drüben achten. Aus dem Aberglauben ist eine Bewegung mit wissenschaftlichem Anspruch geworden, die sogar bei den Physikern Pierre und Marie Curie oder dem Evolutionsforscher Alfred Russel Wallace auf Interesse stößt.
Auch in Deutschland öffnen sich die intellektuellen und adeligen Eliten dem Dialog mit der Geisterwelt. Selbst Kaiser Wilhelm II. nimmt bisweilen inkognito an Séancen teil, um etwa Geheiminformationen über den russischen Zaren zu erlangen.
Die Ratschläge seines entlassenen Kanzlers Bismarck aber verschmäht er. Der marschiert derweil verdrossen durch die ewigen Jagdgründe seiner Güter, die sich über drei preußische Provinzen erstrecken – darunter Varzin in Pommern und Schönhausen in der Altmark, seit 1562 in Familienbesitz.
Seine wichtigste Bastion aber ist die Herrschaft Schwarzenbek mit dem Sachsenwald und dem Gutshaus Friedrichsruh, die ihm Kaiser Wilhelm I. 1871 zum Geschenk gemacht hat – mit direktem Eisenbahnanschluss von Berlin. Dort west er, umsorgt von der schlichten Gattin Johanna, inmitten einer Kargheit, die manchem Gast Unbehagen über den Rücken jagt.
Das Gutshaus ist ein ehemaliges Hotel, dessen Türen zum Teil noch Zimmernummern tragen, dekoriert mit den Porträts von Staatsmännern vergangener Zeiten. Der einzige Luxus im Schlafzimmer ist ein Turnapparat für Bismarcks gymnastische Übungen. Im Arbeitszimmer lagern zwei Deutsche Doggen, die "Reichshunde", auf floral gemusterten Sesseln.
Durch diese Kulisse tappt der ehemalige Kanzler mit fahlem, bisweilen vom Wein gerötetem Gesicht, in seinen gewohnten schweren Stiefeln, seinem altmodischen, zugeknöpften Tuchrock und seiner weißleinenen Halsbinde, wie sie im 18. Jahrhundert modern gewesen ist – ein wandelndes Museumsstück, das seine Steifheit noch unterstreicht, indem es den Stock hinter dem Rücken unter die Arme klemmt.
Dort verkriecht sich Bismarck in seinem Sessel mit einer meterlangen Pfeife, die er bisweilen von anwesenden Damen anrauchen lässt, und einem halben Dutzend Zeitungen, die er auf Stil- und Syntaxfehler durchkämmt, mit seinem langen Bleistift korrigiert und nach der Lektüre achtlos auf den Boden wirft.
In diesen Räumen schaufelt er unter langen Monologen Mengen an Nahrung in sich hinein, vertilgt schon zum Frühstück Hummer, Gänsebrust, Sprotten, Rauchfleisch, Beefsteaks und Eierkuchen, dazu Wein, Sekt, Kaffee und Korn.
Trotzdem schwinden ihm allmählich die Kräfte. Chronisch plagen ihn Ischias und Gürtelrose, Atemnot und Nervenschmerzen. Immer höhere Morphiumdosen braucht der gequälte Leib (bis der Leibarzt nur noch jene Tage notiert, an denen der Fürst kein Betäubungsmittel bekommt).
So verflüchtigt sich der kränkelnde Greis zunehmend zu einem Schemen – der aber real genug ist, das Leben des Kaisers zu verdunkeln: "Ich bin der dicke Schatten", sagt er, "der zwischen ihm und der Ruhmessonne steht."
Denn anders als vom Kaiser erwartet, meldet sich Bismarck, der als Kanzler nur selten in den Parlamenten gesprochen und seit 1878 ausländischen Journalisten keine Interviews gegeben hat, jetzt unablässig zu Wort.
Zwei Wochen nach seinem Abschied spricht er vor einer Abordnung deutscher Industrieller, um seine Version der Entlassung zu verbreiten. Kurz darauf erläutert er einem Vertreter des "New York Herald" seine Sicht des politischen Geschehens, dann dem Pariser "Matin" und der russischen "Nowoje Wremja". In Deutschland ist es ein Zirkel höriger Journalisten und Schriftsteller, der regelmäßig in Friedrichsruh Marschbefehle entgegennimmt. Bismarcks Privatsekretär hat die Aufgabe, die Verbreiter der Botschaften zu überprüfen und deren Protokolle und Artikel zu redigieren, bis sie zur Veröffentlichung taugen.
Das getreueste Medium des Ex-Kanzlers ist Hermann Hofmann, ein politischer Redakteur der "Hamburger Nachrichten", deren Besit zer Bismarck ausdrücklich "das gesamte weiße Papier" seiner Zeitung zur Verfügung gestellt hat. Den von Schulden geplagten Hofmann verpflichtet sich der Herrscher des Sachsenwaldes durch groß zügige Kredite.
So innig fühlt sich Hofmann in Gedanken und Diktion des Fürsten ein, dass es selbst für Bismarcks Sohn Herbert manchmal unmöglich ist, zu entscheiden, ob ein Text von seinem Vater oder dem Journalisten stammt. Immerhin verfasst der Altkanzler persönlich fast 1000 Artikel, die nach seiner Entlassung in dem Blatt veröffentlicht werden.
Es ist eine Verbindung, die im Interesse beider Seiten liegt: Seit die "Hamburger Nachrichten" das Sprachrohr Bismarcks sind, finden sie verstärkte Beachtung in Reich und Welt. Denn alles, was an Interviews und Reden aus Friedrichsruh nach außen dringt, erregt fast ebenso viel Interesse wie die offiziellen Verlautbarungen aus Berlin.
Auch der schillernde Publizist und ehemalige Schauspieler Maximilian Harden ist mit von der Partie: 1892 gründet er allein deshalb, wie er beteuert, die Zeitschrift "Die Zukunft", um "die Größe, die Bedeutung des Fürsten, das Unrecht, das ihm geschehen ist und seinem Werk noch stündlich geschieht, in helles Licht zu rücken". In seinem Blatt verklärt Harden den Altkanzler zur "Vollendung germanischen Geistes" und zur "größten und reizvollsten Erscheinung der germanischen Welt".
Otto von Bismarck lehnt die neue Großmachtpolitik ab
Eine Erscheinung: Das Wort trifft es genau. Otto von Bismarck ist zum Poltergeist geworden, der stets verneint. Um konstruktive Politik geht es ihm längst nicht mehr, Vorschläge für die Zukunft sind von ihm nicht zu erwarten. Stattdessen grollt er und grantelt, schwelgt in der Vergangenheit. Beklagt den Tag, an dem ihn der Kaiser "wie einen Bedienten weggejagt" habe. Murrt, dass er sich "im deutschen Volke offenbar getäuscht habe".
Er wettert gegen alles, was aus Berlin kommt: gegen Handelsverträge, Ostasienpolitik und die neue Landgemeindeordnung, gegen Steuer- und Heeresreform. Warnt vor Minderheiten – "Der Pole ist Intrigant, Heuchler, unwahrhaftig und unzuverlässig, zur Erhaltung eines Staatswesens gänzlich unfähig" – und Sozialdemokraten: "Sie sind die Ratten im Lande und sollten vertilgt werden."
Sein Rezept: "Zuweilen besteht das echte Wohlwollen darin, Blut zu vergießen: das Blut einer aufrührerischen Minorität, und zwar zur Verteidigung der ruheliebenden Majorität."
Die Vorausschau seiner aktiven Jahre opfert er jetzt dem Ressentiment; nur seine Ablehnung der neuen Großmachtpolitik, mit der Wilhelm II. Deutschlands "Platz an der Sonne" sichern will, wird sich im Nachhinein als hellsichtig herausstellen. Jeder, der im nachbismarckschen Deutschland etwas zu sagen hat, kann Ziel seiner Heimsuchungen werden.
Der Altkanzler schießt gegen Karl Heinrich von Boetticher, einst sein treuester und vertrautester Gehilfe und jetzt Stellvertreter des neuen Reichskanzlers, und gegen Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein, den Nachfolger seines Sohnes Herbert als Staatssekretär im Auswärtigen Amt: Dem Ersten wirft er vor, zu seinem Sturz konspiriert zu haben, dem Zweiten, sein Amt ohne jede Sachkenntnis auszuüben.
Vor allem aber nimmt er sich Leo von Caprivi vor, jenen tüchtigen, aber unerfahrenen Mann, der den fatalen Fehler hat, sein Nachfolger im Kanzleramt zu sein. Der ehemalige General ist nach Bismarcks Ansicht unter anderem dem Irrtum erlegen, die Arbeiter mit Reformen gewinnen zu wollen. Zudem hat Caprivi den Rückversicherungsvertrag mit Russland nicht verlängert: Deshalb setzt ihm der Vorgänger auch noch das (in Wirklichkeit schon während seiner eigenen Amtszeit) abgekühlte Verhältnis zum Zaren auf die Rechnung.
Als "Capriviolen" beschimpft Bismarck den "Neuen Kurs", der jetzt das Reich regiert – und seine publizistischen Vasallen rechnen sich jeden Prozess wegen Kanzlerbeleidigung zur persönlichen Ehre an: "Gott sei Dank" sei auch er endlich angeklagt, meldet stolz der Berlin-Korrespondent der "Leipziger Neuesten Nachrichten" nach Friedrichsruh, als ihm wegen seiner Behauptung, "dass Se. Exc. ein Esel sei", drei Monate Gefängnis drohen.
Stets aber vermeidet es der Altkanzler, Wilhelm II. direkt anzugreifen. Er weist seine Sprachrohre sogar an, "den Kaiser etwas mehr zu schonen": Denn sein tiefer preußischer Royalismus verbietet es Bismarck, einem Herrscher offen den Respekt zu versagen.
Bismarcks Memoiren werden zur "deutschen Bibel"
Lieber verschiebt er die Abrechnung auf das Leben nach dem Tod. Seine Memoiren, posthum zu veröffentlichen, soll Lothar Bucher in lesbare Form bringen, der langjährige Sekretär und Gehilfe des Kanzlers.
Doch bald muss der Lektor feststellen, dass Bismarcks "Gedächtnis mangelhaft" ist. Mehr noch: "Er fängt an, auch absichtlich zu entstellen, und zwar selbst bei klaren, ausgemachten Tatsachen und Vorgängen. Bei nichts, was misslungen ist, will er beteiligt gewesen sein." Spätere Historiker lassen daher auch kaum ein Faktum in den "Gedanken und Erinnerungen" gelten. Dennoch wird das Werk zur "deutschen Bibel", die auch ungelesen in jedem Regal steht – und auf lange Zeit das Bild Bismarcks in der Öffentlichkeit bestimmt.
Und der Verlag Cotta in Stuttgart, der für vergleichsweise bescheidene 100 000 Mark pro Band die Rechte an den Memoiren erwirbt, wird nach Bismarcks Tod von den ersten beiden Bänden (der dritte erscheint erst 1921) binnen weniger Tage mehr als 300 000 Exemplare verkaufen und einen Millionengewinn einfahren – kein Wunder, dass der Verleger das Angebot der Regierung ablehnt, ihm das Veröffentlichungsrecht für eine halbe Million Mark abzukaufen, um gegebenenfalls vor dem Druck die "nötigen Änderungen" an dem Manuskript vorzunehmen.
Das Gespenst Bismarck scheint mehr daran interessiert zu sein, Berlin in Angst und Schrecken zu versetzen, als wirklich noch einmal ins politische Geschehen einzugreifen.
Auch seine Kandidatur für die Nationalliberalen bei einer Reichstagsnachwahl 1891 scheint nur dazu bestimmt, den Widersachern Gänsehaut über den Rücken zu jagen – das errungene Mandat übt er nicht ein einziges Mal aus. "Ich würde erscheinen wie Banquos Geist an Macbeths Tisch", orakelt er süffisant, "und mancher alte Freund hat ohnehin schon ein böses Gewissen mir gegenüber."
Kein Zweifel: Er spürt, dass seine Klopfzeichen aus der Ferne mächtiger sind als aus der Nähe. Und als er 1892 ankündigt, zur Hochzeit seines Sohnes Herbert nach Wien zu reisen, verlieren Hof und Regierung die Nerven. Plant der Alte einen politischen Coup? Vorsorglich befiehlt Kanzler Caprivi seinem Botschafter in Wien, keinesfalls eine Einladung zur Hochzeit anzunehmen. Und Wilhelm II. beschwört Österreichs Kaiser Franz Joseph, dem "ungehorsamen Untertan" jede Audienz zu verweigern, "ehe er nicht sich mir genähert und peccavi gesagt hat" (was "ich habe gesündigt" bedeutet). Auch der König von Sachsen und Bayerns Prinzregent erhalten diese Bitte.
Überall wird Bismarck von Menschenmassen gefeiert
Doch der Schrecken aus dem Sachsenwald lässt sich so nicht verscheuchen. Im Gegenteil: Er bläht sich ins Monströse. Während Amtsträger allerorten weisungsgemäß den Kontakt vermeiden, stehen überall jubelnde Massen bereit, um ihm zu huldigen, trotzen Regen und Polizeisperren.
In Wien begleiten ihn die Ovationen ins Theater, in den Prater, ins Konzert. Deutschnationale prügeln sich mit Polizisten, fahren mit 60 Kutschen vor, um den Fürsten zu ehren, schmettern bei seiner Abreise auf dem Bahnhof die "Wacht am Rhein".
In München paradieren 1600 Korpsstudenten mit Fackeln und in vollem Wichs. Begeisterte Massen blockieren noch lange nach dem letzten Hurra-Ruf die Straßen, bis der Oberbürgermeister ihnen mitteilt, der Fürst habe sich zur Nachtruhe zurück zu begeben. In Augsburg wartet ein Chor von 700 Sängern, in Würzburg huldigen Rektor und Senat der Universität, flankiert von einer 8000-köpfigen Menge. In Bad Kissingen regnen Blumen auf ihn herab. In Jena erwarten ihn 25 000 Menschen im strömenden Regen; weiß gekleidete Mädchen eskortieren ihn, Blumen streuend, zum "Bären", wo er jene Zimmer bezieht, in denen einst Martin Luther gewohnt hat.
Tags darauf spricht er auf dem Marktplatz vor mehr als 20 000 Zuhörern – die einen pfeifenden Gegner, wie Bismarcks Diener berichtet, so "energisch zur Ruhe" bringen, dass der "dabei seine Vorderzähne eingebüßt" haben soll.
So wird der schlichte Besuch einer Familienfeier zur "groß deutschen Rundfahrt", die Hunderttausende Menschen und die Diplomatie zweier Kaiserreiche in Bewegung setzt. Sie wird zum Propaganda-Marathon mit 25 Ansprachen auf Bahnhöfen, in Rathäusern und auf öffentlichen Plätzen. Selbst in Berlin, der Bastion des Kaisers, fordert die Menge: "Reden! Reden!"
Und Bismarck redet. In dem Raunen aus Friedrichsruh finden sich Deutschkonservative, Freikonservative und Nationalliberale in seltener Einheit. Erkennen sich die Schlotbarone des Westens, die Wilhelms sozialpolitische Experimente missbilligen, ebenso wie die Grundbesitzer und Landwirte, die Caprivis Herabsetzung der Getreidezölle verdammen. Treffen sich Kolonialschwärmer und Alldeutsche, die wie Bismarck das Helgoland-Sansibar-Abkommen ablehnen, in dem Deutschland Gebiete in Afrika an England abtritt und Helgoland erhält (obwohl Bismarck den Vertrag als Kanzler noch vorbereitet hat).
Dabei wird er nicht zum Anführer dieser Opposition – ja "nicht einmal ihr gemeinsamer Nenner", so sein Biograf Manfred Hank. Er ist vielmehr ihr Schutzschild, ihr Alibi, ihre Galions figur für die Kritik an dem unberührbaren Kaiser in Berlin.
Der ewige Nimbus des Ex-Kanzlers umgibt Bismarck
Friedrichsruh wird zum Wallfahrtsort aller Unzufriedenen im Land: Aus dem gesamten Reich strömen Abordnungen an sein Gutstor; dazu Deutschstämmige aus Russland oder den USA. Sie bringen Ehrenbürgerschaften und Doktorwürden dar, Prunkpokale und Gedenktafeln. Sie marschieren mit Fackeln, Gesang oder klingendem Spiel.
Im Verlauf von knapp sechs Jahren finden sich rund 150 solcher Pilgergruppen bei ihm ein – manche mehrere Tausend Köpfe stark. Häufig belohnt sie Bismarck mit einem knappen Wort des Dankes, bisweilen auch mit einer Rede vom Balkon. Er spricht meist leise, mühsam, stockend, mit seiner, wie Besucher berichten, "dünnen, fast schüchtern klingenden Stimme", die mit einer "eigentümlichen, suchenden, pausierenden Langsamkeit" seinem Mund entweicht.
Den Nimbus des Ex-Kanzlers kann das nur noch steigern. Schulklassen belagern das Parktor tagelang bei Wind und Regen und begrüßen ihn bei jedem Erscheinen mit Liedern, Hochrufen und geschwenkten Tüchern. Manche Fanatiker streuen Rosen auf seinen Weg und wickeln die Erde, die seine Füße berührt hat, in Taschentücher. Andere sammeln Bismarcks abgebrannte Streichhölzer oder heben Haare seiner Doggen zum Andenken auf.
Und fast allen schlottern die Knie, wenn ER vor ihnen steht. Sogar die Gesellschafterin seiner Ehefrau durchfährt ein heiliger Schrecken, sobald "der Gewaltige" sie anredet. Selbst ein Dauergast wie Bismarcks Leibmaler Franz von Lenbach verlässt das Gutshaus regelmäßig "fast mit einem Gefühl der Erleichterung".
In Berlin wird der Kaiser derweil immer wütender und pocht trotzig auf sein Machtmonopol: "Einer nur ist Herr im Reiche, und das bin Ich, keinen anderen dulde Ich." Wieder und wieder erwägt er Bismarcks Verhaftung.
Doch er weiß, dass solches Märtyrertum die Aura des einstigen Kanzlers nur noch heller erstrahlen lassen und den Spuk, der Wilhelms "persönliches Regiment" vernebelt, ins Unbeherrschbare steigern würde. Und als der Verhasste 1893 an einer Lungenentzündung erkrankt, fällt der Hof in Panik: Was wären die politischen Folgen, sollte der Alte vom Sachsenwald sterben, ohne zuvor vom Kaiser die Absolution erbeten zu haben?
Wahrscheinlich ist es Philipp zu Eulenburg, nicht nur Wilhelms engster Vertrauter, sondern auch heimlicher Spiritist, der dem Kaiser die Besänftigung des bösen Geistes im Sachsenwald ans Herz legt.
Schon unmittelbar nach Wilhelms Thronbesteigung hatte sich Eulenburg als Experte für übersinnliche Kontakte angedient und den Monarchen gedrängt, "sich in diesen heiklen und aufregenden Dingen nur meiner Vermittlung zu bedienen".
Und so tief auch Philipp zu Eulenburgs Abneigung gegen den "moralisch und physisch ungewaschenen Herkules" von Friedrichsruh ist – so dringend erscheint ihm angesichts Bismarcks wachsender Popularität die Notwendigkeit, die Monarchie zu schützen und mit diplomatischen Mitteln die Staatsseele von der "dämonischen Natur" ihres Inkubus zu befreien.
Ohnehin ist der Kaiser in der sozialen Frage, über die der Konflikt zwischen den beiden Männern einst ausgebrochen war, längst auf Bismarcks Linie eingeschwenkt: Schon im März 1890, als in Gelsenkirchen Arbeiter streikten, hat er seinen Generälen befohlen, "bei der ersten Gelegenheit die Repetiergewehre spielen zu lassen". Und als die Sozialdemokraten bei der Reichstagswahl im Juni 1893 mit 23,3 Prozent die meisten Stimmen erhalten, fordert er persönlich schärfere Gesetze gegen Revolutionäre.
Am Ende ist es vor allem die Last des Friedrichsruher Albdrucks, dieser schaurig wachsende Kult um den Reichsgründer, der Wilhelm II. zwingt, der ideellen Annäherung die physische folgen zu lassen.
Im Januar 1894 schickt der Kaiser einen Adjutanten nach Friedrichsruh: mit einem Handschreiben und einer Flasche 1862er Steinberger Cabinet, die der Ruheständler mit unbewegter Miene entgegennimmt. Unverbindlich stellt der Adjutant die Möglichkeit eines Besuchs Bismarcks in Berlin in den Raum – die der Beschenkte auch akzeptiert. Damit hat der Kaiser den Eröffnungszug getan, ohne den Gegner ausdrücklich einzuladen; keine der beiden Parteien verliert ihr Gesicht.
Am 26. Januar 1894 legt Bismarck seine Generalsuniform an und macht sich auf die Reise. Als er im geschlossenen Wagen durch die flaggengeschmückten Straßen Berlins rollt, eskortiert von einer Schwadron Gardekürassiere, stehen mehr als 300 000 Berliner zu seinem Empfang bereit, dazu eine Delegation von Offizieren unter Leitung des Kaiserbruders Prinz Heinrich.
Am Stadtschloss schreitet der Gast unter Jubel und Marschmusik eine Ehrenwache ab. In Begleitung Prinz Heinrichs betritt er das Schloss. Dort ergreift Wilhelm II. sichtlich nervös die Hand des Alten, küsst ihn auf beide Wangen. Was die beiden Männer dann hinter geschlossenen Flügeltüren bereden, bleibt ihr Geheimnis.
Der Kult um den ehemaligen Reichskanzler nimmt zu
Nach außen aber herrscht nun Harmonie. Der Störenfried hält vorerst still, tauscht artig Geburtstagsgrüße und Geschenke mit dem Monarchen, empfängt ihn einige Monate später zum Gegenbesuch in Friedrichsruh.
Doch dem kaiserlichen Gefolge ist bewusst, dass der "alte Wallenstein im Sachsenwald" seine "Waffen noch nicht niedergelegt" hat, wie ein Höfling notiert. Und so versucht der Kaiser, den Alten zu bestechen.
Im Oktober 1894 entlässt er Bismarcks Lieblingsgegner Caprivi – ausgerechnet wegen dessen Widerstand gegen ein neues Sozialistengesetz. Der Herrscher überschüttet den Ungerührten mit Grußbotschaften, lädt ihn ein zur Eröffnung des Kaiser-Wilhelm-Kanals zwischen Nord- und Ostsee, beschenkt ihn mit selbst gemalten Marinebildern, verleiht ihm den neuen Wilhelm-Orden und den Pour le Mérite der Friedensklasse.
Ein gutes Jahr nach der "Versöhnung", zu Bismarcks 80. Geburtstag am 1. April 1895, nimmt der Kult um den Altkanzler dann nie gesehene Ausmaße an. Von März bis Juni halten 35 Sonderzüge am Bahnhof Friedrichsruh, an Bord mehr als 50 Delegationen: deutsche und ausländische Regierungsvertreter, der Reichskanzler, dazu mehr als 400 Land- und Reichstagsabgeordnete, 4000 Korpsstudenten in Uniform, die Rektoren aller deutschen Universitäten in Barett und Talar.
Am 26. März erscheint der Kaiser persönlich, mit Pickelhaube und Brustpanzer zu Pferde, begleitet von Kronprinz, Kriegsminister und einem Aufgebot von Infanterie, Artillerie, Husaren und Halberstädter Kürassieren.
Im offenen Wagen inspiziert Bismarck die aufgestellten Truppen, genießt das Feuerwerk aus Fahnen, Kapellen und Kanonendonner – doch so jovial die Avancen des Kaisers auch sind, so kühl bleibt die Verachtung des Jubilars. Das Volk belagert tagelang die Ziegelmauern des Anwesens, kauft fliegenden Souvenirhändlern Bismarck-Devotionalien ab: Medaillen, Festblätter, Fotografien auf Eichenholz. Postboten bringen fast 10 000 Telegramme und 450 000 Kartengrüße, Briefe und Drucksachen, dazu mehrere Tausend Päckchen.
Bismarcks Bedienstete listen insgesamt genau 1109 Geschenke auf – von der "Runentafel aus Eichenholz", verehrt vom Männergesangverein Germania aus München, bis zur "Kugel, gefunden auf dem Schlachtfelde bei Leipzig in unmittelbarer Nähe Napoleons" als Gabe des Deutschen Patriotenbunds.
Gut 450 Städte, von Altona bis Zwickau, verleihen ihm die Ehrenbürgerschaft. Erdbeeren, Heringe und Zigarren tragen fortan seinen Namen. Städte und Dörfer schmücken sich mit Straßen, Plätzen und Schulen, die nach Bismarck benannt werden. 500 Denkmäler wachsen nach und nach aus dem Boden, Dutzende davon noch zu Lebzeiten. Meist stellen sie den Fürsten als martialischen Hünen mit Pickelhaube, Stulpenstiefeln, Säbel dar und jenem "tiefen, geisterhaften Fernblick des vorausschauenden Weisen", der schon manchen Besucher in Friedrichsruh schaudern ließ.
Bismarck behält den Hass gegen Kaiser Wilhelm II. bis zu seinem Tod
Und während er so zum Monument wird, scheint sein irdischer Leib sich weiter aufzulösen: Er fühlt sich jetzt derart matt, dass er fürchtet, das Jahr nicht zu überleben. Seine schlecht durchbluteten Beine machen ihm das Aufsatteln unmöglich.
Auch sein Sohn erkennt an "Gang und Haltung" des Alten eine "langsame, aber stetige" Abnahme der Kräfte. Und wenn sein Arzt ihn mahnt, weniger Alkohol und Medizin zu schlucken, knurrt er: "Lassen Sie mich doch ruhig sterben, ich habe genug."
Doch als müsse er noch einmal für Grauen sorgen, rafft er sich im Oktober 1896 zum letzten Spukangriff auf: Ohne sichtbaren Grund lässt er in den "Hamburger Nachrichten" den Inhalt eines geheimen Rückversicherungsvertrages mit Russland veröffentlichen.
Darin hatten Berlin und Sankt Petersburg 1887 eine gegen Wien gerichtete Defensivallianz vereinbart, obwohl Deutschland zuvor mit der Habsburger-Monarchie ein ähnliches Bündnis gegen das Zarenreich eingegangen war. Diese "politische Bigamie", wie ein Diplomat schrieb, drohte die Glaubwürdigkeit des Deutschen Reiches zu beschädigen; daher hat Bismarcks Nachfolger Caprivi den Vertrag mit den Russen 1890 nicht verlängert.
Nun, nach der Veröffentlichung, hat das Auswärtige Amt große Mühe, Wien und Sankt Petersburg zu beruhigen. Erneut droht der Kaiser, Bismarck wegen Hochverrats einsperren zu lassen, doch sein Gefolge rät ihm ab – angesichts "der fieberhaften Erregung im Lande und bei dem bornierten Fanatismus der Menge, welche den Alten anbetet wie Baal".
Der neue Kanzler Chlodwig zu Hohenlohe ist ein alter Weggefährte des Fürsten, der seinen Respekt durch zwei Pilgerfahrten nach Friedrichsruh unterstreicht (später wird Wilhelm beteuern, er habe Hohenlohe eigens ernannt, um Bismarck zur Ruhe zu bringen). 1897, als die zweite seiner Deutschen Doggen stirbt, verliert der Alte den letzten Mut: "Nun sind meine Hunde weg", klagt er, "nun komme ich an die Reihe."
Ende 1897 diagnostiziert der Hausarzt Brand in Bismarcks linkem Fuß. Die Schmerzen steigern sich zum "Höllensabbath", verschärft durch einen der unwillkommenen Besuche des Kaisers – der, wie er hinterher im kleinen Kreis verrät, nur nachsehen wollte, "wie weit der Altersbrand beim Fürsten fortgeschritten und wann dessen Tod zu erwarten ist".
Bismarck muss seinen Abscheu darauf beschränken, Fünfmarkstücke mit dem Kaiserporträt nach unten auf den Tisch zu legen, um "das falsche Gesicht" nicht zu sehen. Bald kann er seinen Park nur noch im Rollstuhl inspizieren. Im Juli 1898 ist er so schwach, dass er das Schlafzimmer kaum mehr verlässt.
Am 28. Juli rafft er sich noch einmal auf, stärkt sich mit einem kühlen Glas Champagner, isst mit seiner Familie, raucht sogar drei Pfeifen und liest die Zeitung – doch kurz darauf ereilt ihn ein Lungenödem. Er fiebert, verliert häufig das Bewusstsein.
Am 30. Juli, eine Stunde vor Mitternacht, stirbt Otto von Bismarck mit 83 Jahren. Seine Begräbnisstätte im Sachsenwald hat er noch selbst bestimmt, auf einem grasbewachsenen Hügel, zwischen Eichen, Buchen und Ahornbäumen. In einem Mausoleum aus mächtigen Steinquadern wird er am 16. März 1899 zur Ruhe gelegt. Der Kaiser folgt dem Sarg in Uniformmantel und Helm.