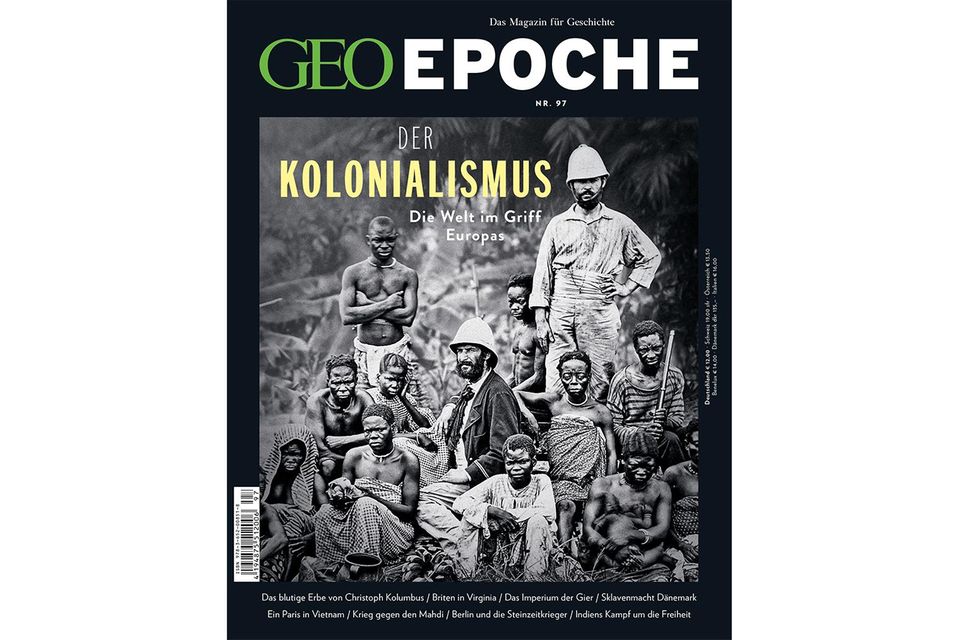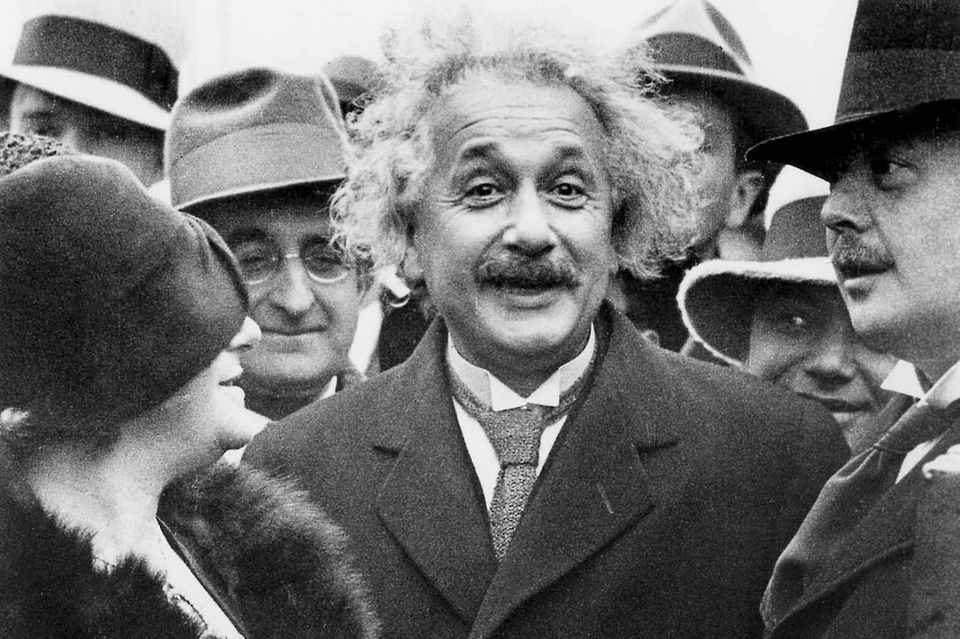Er präsentiert seinen Körper: eine Skulptur des Leidens. Am 2. September 1947 stellt er ihn, für alle sichtbar, auf einer Pritsche in einem offenen Raum seines Hauses zur Schau. Von nun an, kündigt er an, werde er nichts mehr essen und nichts trinken bis auf ein paar Schluck Wasser, und wenn es sein muss, will er sterben.
Es ist ein geschundener Körper, den Mohandas Gandhi, genannt Mahatma, die "Große Seele", dem Publikum zeigt. Halb nackt ist er, in nichts als ein weißes Lendentuch gehüllt. Der Mund ist fast zahnlos, der Schädel kahl, und die Ohren stehen weit vom Kopf ab. Doch es ist etwas Heiliges um den Mann, der dort liegt.
Denn dies ist kein Fasten, das der persönlichen Läuterung dient. Es soll nicht den Fastenden reinigen, sondern ganz Indien. Es soll die Epidemie der Gewalt zwischen Hindus und Muslimen heilen, die seit Monaten das Land krank macht – jetzt auch die Stadt Kalkutta.
Es ist ein Ritual, und wie jedes Ritual stiftet es Gemeinschaft. Massen sind herbeigeströmt, um daran teilzuhaben. Sie sammeln sich an dem heruntergekommenen Haus in einem Vorort Kalkuttas, das Gandhi bezogen hat. Er lebt zwischen Slumhütten und Häusern, in denen sich muslimische Flüchtlinge aus Ostbengalen drängen und Hindus mit Maschinenpistolen und selbst gebauten Granaten Jagd auf ihre islamischen Nachbarn machen.
Gewalt gilt vielen als einzige Lösung
Doch seit der 77-Jährige fastet, sind die Hetzer der Hetze müde. Zerknirscht ziehen sie vor sein Haus mit den neun Meter hohen Decken, zerschmetterten Türen und Fenstern und dem scharfen Geruch nach Ammoniak, um ihren Friedenswillen zu bekunden.
Rowdies werden zu reuigen Pilgern, Schläger stehen stundenlang weinend an seinem Lager, eben noch grimmige Kämpfer legen Waffen zu seinen Füßen nieder. Und Tausende in der Stadt fasten mit, um das Fasten des Mahatma zu unterstützen – es womöglich zu beenden.
Und tatsächlich. Das Wunder geschieht. Schon am zweiten Tag des Rituals ebben die Unruhen ab. Am dritten Tag erscheinen die Chefs der verfeindeten Gruppen an Gandhis Pritsche: Anführer der von Hindus dominierten Kongresspartei, der Muslimliga, der Sikhs, sogar der militanten Hindu-Mahasabha-Partei. Sie alle flehen den alten Mann an, sein Fasten zu beenden.
Der stellt zwei Bedingungen. Zum einen hat die Gewalt unverzüglich aufzuhören. Zum anderen sollen die Delegierten der verfeindeten Gruppen mit ihrem eigenen Leben haften, falls die Unruhen von Neuem aufflammen.
Die Männer sammeln sich zur Beratung im Nebenzimmer. Dann kommen sie mit einem unterschriebenen Vertrag zurück. Gandhi beendet sein Fasten mit einem Glas gesüßten Limonensafts, und die Besucher stimmen ein bengalisches Lied an: "Wenn das Herz hart und dürr ist, überschütte mich mit einem Schauer der Gnade. " Für Monate endet die Gewalt in Kalkutta.
Es ist das 16. Mal, dass Gandhi für sein Land fastet. Und längst ist dieses Fasten größer geworden als der Mensch, der es vollzieht. Es ist ein Staatsakt, eine Zeremonie, eine heilige Handlung: Wenn der Mahatma fastet, singen seine Anhänger Hymnen, geloben Buße und Besserung. Sie sitzen nachts in ihren dunklen Häusern, ohne Kerzen oder Lampen anzuzünden, und sprechen nur noch im Flüsterton.
Und genau genommen ist dieses Fasten gar kein Akt jener Gewaltlosigkeit, die man mit Gandhis Namen verbindet. Es ist vielmehr eine besonders radikale Gewalttat: gegen das eigene Fleisch.
Es ist ein Opfer, das geradezu religiöse Züge hat. Denn im Opfer, so lehren die alten Schriften, schafft der Priester einen Mikrokosmos, der auf den Makrokosmos einwirkt: die Welt, das Universum, die Götter.
Und in Gandhis Verständnis bedeutet dies auch die Opferung seiner selbst – "die Bereitschaft", wie er es formuliert, "sein eigenes Leben zu lassen für wahres Gemeinwohl".
Vielleicht ist es ein Missverständnis, ihn als Politiker zu begreifen. Seine Neigung, verkündet er, sei "nicht politisch, sondern religiös". Und mehr als um Indiens Freiheit geht es ihm um dessen Reinigung.
Denn auch wenn er große Menschenmengen anzieht, glaubt Gandhi nicht an Massenbewegungen – sondern an die Wahrheit, die im Einzelnen wohnt. "Die Wahrheit", schreibt er, "transzendiert die Geschichte. "
Wahrheit: Das ist die Sache des Individuums, das sich selbst zum Einsatz macht. Ihr Königsweg ist das Gelübde – ein immer wieder erneuerter Pakt mit dem Universum. Die Kraft, lehrt Gandhi, liegt beim Einzelnen. Und sie verändert die Welt.
Gandhi will "so nackt wie nur möglich" sein
Schon 1888, als er mit 18 Jahren zum Jurastudium nach London aufbricht, gelobt Gandhi, dort weder Fleisch, Alkohol noch Frauen anzurühren. Und als er 1893 im Auftrag eines indisch-muslimischen Händlers als Rechtsbeistand für eine Zweigstelle ins südafrikanische Durban, eine Hafenstadt in der britischen Kolonie Natal, geht und sich dort bald auch für die Rechte der gedemütigten indischen Minderheit einsetzt, entwickelt er die Methode des Selbstopfers, die ihn berühmt machen soll.
Mit einem Sanskrit-Wort nennt er sie satyagraha, wörtlich "Festhalten an der Wahrheit" – über alle Widerstände, Erniedrigungen und Schmerzen hinweg.
Es bedeutet, um der guten Sache willen Qualen zu dulden: Beleidigungen, Schläge von Polizeiknüppeln, ruinöse Gewaltmärsche. Es gilt, Demütigungen nicht nur hinzunehmen, sondern bewusst zu suchen. Auch die zahlreichen Gefängnisaufenthalte, die Gandhi mehr als fünf Jahre seines Lebens kosten, werden ihm so zur "höchsten Seligkeit".
Dafür verbietet er sich Tee, Salz, Hülsenfrüchte und Milch, gewürztes und meist auch gekochtes Essen. Und legt (ohne seine Frau Kasturba zu fragen) ein Keuschheitsgelübde ab: Denn auch sexuelle Energie, glaubt Gandhi, sollte in spirituelle Kraft umgemünzt werden – die dann die materielle Umwelt verwandelt.
Mit diesem Glauben kämpft er in Südafrika gegen das Unrecht. Er sammelt Gleichgesinnte gegen ein neues Wahlgesetz, das Indern in der Kolonie Natal das Stimmrecht verweigert, und gegen eine ruinöse Steuer, die sie nach Ende ihrer Dienstzeit entrichten müssen, um auch ohne Kontrakt im Land bleiben zu können. Er organisiert Boykottaktionen gegen ein Gesetz, das indische Ehen für ungültig erklärt, und nimmt gelassen in Kauf, dass er dabei fast gelyncht wird und immer wieder im Gefängnis landet.
Und er triumphiert: Die Kopfsteuer wird reduziert (in der benachbarten Region Transvaal sogar völlig abgeschafft), die indische Ehe wird für rechtsgültig erklärt. Dieser Einsatz für die Landsleute spricht sich auch in der Heimat herum. Und als er 1915 nach Bombay zurückkehrt, empfangen ihn am Hafen schon jubelnde Massen.
Denn auch hier hat die Empörung gegen die britische Kolonialmacht längst begonnen.
Gegen diese Fremdherrschaft, die sich zu Beginn des 17. Jahrhunderts fast unmerklich eingenistet hat, mit einer Handvoll Schiffe, mit Handelsstützpunkten an den Küsten, mit Aktgemälden als Geschenken an den seinerzeit über weite Teile des Subkontinents herrschenden muslimischen Großmogul. Mit der privaten Gewalt der "East India Company", die bald auch Steuern eintreibt und eine eigene Firmenarmee aus einheimischen Söldnern rekrutiert; die Silber nach Indien und Gewürze und Baumwolle von dort ins Mutterland schafft und die mit indischem Opium halb China vergiftet, um den Stoff dort gegen Tee einzutauschen.
Bereits 1857 jedoch hat eine Rebellion indischer Söldner gegen die britische Herrschaft die Region an den Rand der Unregierbarkeit gebracht: Als Reaktion beendete das Parlament die Herrschaft der Company.
1858 wurde Indien offiziell zur Kolonie mit einem Vizekönig an der Spitze, der fortan als Generalgouverneur seine Untertanen direkt oder mittels 600 von der Kolonialmacht abhängigen Fürsten beherrschte. Und 1876 nahm, um die Herrschaft der Krone zu unterstreichen, Queen Victoria den Titel "Kaiserin von Indien" an.
Bald darauf, 1885, gründeten indische Intellektuelle einen "Nationalkongress", um mehr Mitbestimmung und Menschenrechte für Einheimische zu verlangen. 1905 streikten landesweit Arbeiter, boykottierten Salz aus Liverpool und verbrannten Kleidung aus Manchester. Und 1911 musste König Georg V. Indiens Regierungssitz von Kalkutta nach Delhi verlegen, weil eine Serie von Terroranschlägen Bengalen ins Chaos stürzte.
Allmählich geht das Aufbegehren nun durch die ganze kolonialisierte Welt. Während in Europa der Erste Weltkrieg tobt, revoltieren Westafrikaner und Algerier gegen ihre Mobilmachung durch die Franzosen, formieren sich antikoloniale Gruppen in Vietnam, Tunesien und Ägypten, erheben sich auch in Irland, Korea, China, Syrien und Irak unterdrückte Einheimische gegen die Fremdherrschaft.
Die Kolonialmächte kommen um Zugeständnisse nicht mehr herum. Auch die Briten öffnen ihren Verwaltungsapparat vorsichtig den einheimischen Eliten: Ab 1919 können Inder eigene Vertreter in Lokal- und Regionalregierungen wählen.
Die eigentliche Macht bleibt freilich in den Händen der rund 4000 hochbezahlten britischen Kolonial-Beamten, sowie des Vizekönigs und des Parlaments in London. Und nach wie vor hält Großbritannien seine reichste Kolonie, das "jewel in the crown", mittels Zehntausender eigener und indischer Soldaten in Schach.
Mit deren Hilfe sichert es die Profite seiner Händler, das Prestige einer Großmacht und die strategische Vormachtstellung im asiatischen Raum – und zieht Zwangsabgaben aus dem unterworfenen Subkontinent ab: 150 Millionen Pfund, nach heutigem Wert rund 18 Milliarden Euro, hat Indien allein für Großbritanniens Kriegskosten gezahlt. Und noch immer fließen üppige Tribute nach London.
Im Land aber ertönt immer dringlicher der Ruf nach swaraj – nach Selbstregierung.
Der gewaltlose Protest wird blutig
Auch Gandhi will, dass Indien sich selbst beherrscht. Vor den Toren der Großstadt Ahmedabad gründet er eine Landkommune – deren asketisches Vorbild Indien verwandeln soll. Sex ist dort so verpönt wie Fleisch, Kaffee und Tee. Und Kleidung wird nicht gekauft, sondern selbst gemacht, aus selbst gesponnenem Garn.
Das Spinnrad, in weiten Teilen Indiens fast vergessenes Instrument vorindustrieller Zeiten, macht Gandhi zum neuen Symbol indischer Selbstbesinnung – und zur gewaltlosen Waffe gegen die britischen Textilimporte, die den einheimischen Webern und Garnspinnern das Leben schwer machen.
Der Mahatma, der noch vor Kurzem ein Spinnrad nicht von einem Webstuhl unterscheiden konnte, übt sich nun täglich an dem Gerät, führt auch auf Reisen ein tragbares Exemplar mit sich. Jeden Tag spinnt er eine halbe Stunde und dreht auch auf Versammlungen, anstatt zu reden, oft nur bedeutsam am Rad.
Um am eigenen Leib "das Leben der Ärmsten" zu erfahren, legt Gandhi, der einst mit Vor liebe Anzüge aus Londons Bond Street trug, die Tracht der sadhu an, der indischen Bettelmönche. Um "so nackt wie nur möglich" zu sein, beschränkt er sich auf ein knappes Lendentuch aus eigener Produktion. Die Minimaltracht macht ihn zur Marke, zum nationalen Symbol: In ihr verkörpert Gandhis Leib jetzt das Schicksal Indiens.
Doch sein erster Versuch des gewaltlosen Widerstands endet im Fiasko. Als die Briten 1919 in Indien autoritäre Anti-Terror-Gesetze erlassen, ruft er das Land zum friedlichen Generalstreik auf. Doch viele seiner Landsleute nutzen den Ausstand, um zu plündern, Telegraphendrähte zu zerschneiden und Züge zu blockieren.
In Amritsar nördlich von Delhi toben 40 000 Aufgebrachte durch die Straßen, setzen Häuser in Brand und töten fünf Europäer. Der britische Kommandant der Stadt erlässt ein Versammlungsverbot. Und als am 14. April Zehntausende auf Amritsars Hauptplatz zusammenströmen – die meisten, um einen religiösen Feiertag zu begehen –, lässt er gnadenlos in die unbewaffnete Menge feuern. Nach offiziellen Angaben gibt es 379 Tote und über 1200 Verletzte, tatsächlich aber wohl viel mehr.
Entsetzt bricht Gandhi die Kampagne ab – und fastet drei Tage lang, um sich dafür zu bestrafen. Sein Aufruf sei ein "himalayagroßer Fehler" gewesen: "Ich habe die Kräfte des Bösen unterschätzt."
Drei Jahre später, als er einen Steuerstreik im Distrikt Barjoli organisiert, muss er von Neuem feststellen, wie sein gewaltloser Protest aus dem Ruder gerät. Empörer attackieren einen Polizeiposten, schließen 22 Beamte in der Wache ein und stecken, manche unter Hochrufen auf den Mahatma, das Gebäude in Brand. Flüchtende Polizisten werden von den Aufständischen erschlagen oder in die Flammen zurückgezwungen.
Erschüttert übernimmt Gandhi die Verantwortung, beendet erneut den Streik, verweigert für fünf Tage die Nahrung. Er wird wegen "Verleitung zum Aufstand" angeklagt – und plädiert selbst für die Höchststrafe: Wunschgemäß verurteilt der Richter ihn zu sechs Jahren Gefängnis (von denen er wegen Krankheit aber nur zwei Jahre absitzen muss).
Schon 1920 ist er zum Präsidenten der Kongresspartei gewählt worden. Doch längst sehen seine Anhänger in ihm nicht mehr den Politiker, sondern den Guru. Bei Versammlungen braucht er kein Mikrofon, um Zehntausende Zuhörer zu begeistern – seine schiere Präsenz genügt den Anhängern. Anschließend drängen sie sich, um sein Gewand zu berühren, seine Füße oder Schienbeine.
Bei seinen Zugreisen, die er aus Prinzip im Schmutz und Gedränge der schlechtesten Wagenklasse absolviert, leuchten die Bauern nachts mit Taschenlampen in sein Abteil, um einen Blick auf ihn zu erhaschen.
An jeder Station warten stundenlang die Menschenmassen, blockieren die Gleise, hängen sich an die Trittbretter: "Gandhi ki jai", jubeln sie, Ruhm sei Gandhi! Manchmal, wenn es dem Mahatma zu viel wird, lässt er sich dann, weil ohnehin kaum jemand sein Gesicht kennt, von seinem Sekretär vertreten.
Nicht alle Gegner der britischen Herrschaft lehnen sich so friedlich gegen das Empire auf. Im Dezember 1928 tötet ein Attentäter den stellvertretenden Polizeichef von Lahore, wirft dann im April 1929 zwei Bomben ins Parlament und feuert mit einer Pistole um sich.
Und der Aktivist Subhas Chandras Bose, der sich bald in Anklang an Adolf Hitler "Führer" nennen lassen wird, ruft seine Landsleute zum bewaffneten Widerstand auf: "Gebt mir euer Blut", lautet seine Parole, "und ich verspreche euch Freiheit. "
Auch im Rest der Welt wächst der Widerstand gegen koloniale Herrschaft. Im französischen Vietnam zetteln Nationalisten und Kommunisten Bauernaufstände an. Von Spanisch-Marokko aus greift ein Aufstand auf den französischen Landesteil über. In Indonesien sammeln sich unter Führung des späteren Präsidenten Sukarno junge Empörer gegen die niederländischen Machthaber. Und im nominell unabhängigen Ägypten kämpfen liberale Nationalisten und später Muslimbrüder gegen die weiterhin bestehende britische Kontrolle.
Doch auch in England selbst wachsen die Zweifel am Sinn des Empire. Kommerziell ist der Subkontinent für Großbritannien kaum noch interessant: Die neuen britischen Industrien können mit den Rohstoffen aus Südasien nicht mehr viel anfangen. Von 1865 bis 1920 ist der britische Anteil an Indiens Exporten von 67 auf 22 Prozent gesunken. Und immer mehr Briten erscheint die Kolonie mit ihrem immensen Militär- und Verwaltungsbedarf jetzt als Klotz am Bein.
Die Kolonialmacht schlägt brutal zurück
Am 12. März 1930 beginnt Gandhi seine spektakulärste Aktion. Mit 78 Getreuen bricht er zu Fuß Richtung Meer auf, um gegen eine neue Salzsteuer der Kolonialherren zu protestieren – und gegen das Monopol, das die britische Krone auf das unentbehrliche Gewürz beansprucht.
24 Tage dauert der Marsch; die Aktivisten ziehen durch festlich geschmückte Dörfer, begleitet von einer stetig wachsenden Menge. Als Gandhi am 5. April an der Küste eintrifft, ist der Zug schon auf mehrere Tausend Teilnehmer angeschwollen.
Am nächsten Morgen sammelt er demonstrativ mit Meersalz verkrusteten Sand auf. Damit verstößt er gegen das britische Monopol. Tausende Bauern machen es ihm an den folgenden Tagen nach – ein Gesetzesbruch, der die Kolonialmacht in die Schranken weisen soll.
Die schlägt brutal zurück. Sie verhaftet 60.000 Salz-Piraten, darunter Gandhi. 2500 Demonstranten, die unbewaffnet auf die Salzpfannen von Dharasana nördlich von Bombay zumarschieren, drischt sie Reihe um Reihe mit stahlbeschlagenen Knüppeln nieder, bis Hunderte mit zerschmetterten Schädeln am Boden liegen.
Zwar empfängt der britische Vizekönig Lord Irwin am 17. Februar 1931 Gandhi zu einem fast vierstündigen Gespräch. Er behandelt den Gast durchaus mit Respekt, lässt sich auch nichts anmerken, als der Mahatma demonstrativ einen Brocken illegal geerntetes Salz auspackt.
Gandhis Forderungen aber – die Untersuchung von Ausschreitungen der Polizei, die Rückgabe von im Steuerstreik konfisziertem Bauernland, die Aufhebung der Salzsteuer – lehnt der Brite mit dem Hinweis auf Sachzwänge ab. Die Salzsteuer wird sogar noch erhöht. Und von Unabhängigkeit ist erst recht nicht die Rede.
Erst nach 15 weiteren Treffen willigt Irwin ein, zumindest den unmittelbaren Anrainern von Salzvorkommen das Sammeln und Sieden für den Hausgebrauch zu erlauben. Außerdem will er 100 000 politische Gefangene freilassen – wenn der Mahatma dafür auf weitere Akte zivilen Ungehorsams verzichtet.
Gandhis Gespräche mit britischen Politikern aber, die ihn nach London eingeladen haben, bleiben ohne jeden Erfolg. Im Dezember 1931 kehrt er in die Heimat zurück – und wird schon acht Tage später ein weiteres Mal verhaftet: Ein italienischer Journalist hat nach einem Interview fälschlich berichtet, der Mahatma wolle umgehend wieder zum zivilen Ungehorsam aufrufen.
Doch schon bald scheint es gar nicht mehr das Empire zu sein, gegen das sich Gandhis Aktionen richten. Immer deutlicher wird jetzt, dass es nie sein vorrangiges Ziel war, die Inder zu befreien: Erst einmal will er sie so erziehen, dass sie dieser Freiheit überhaupt würdig sind. Und nichts ist für diese Läuterung eines ganzen Volkes so entscheidend wie dessen Einheit.
So bedeutet der Plan der britischen Regierung, bei den kommenden Wahlen eine separate Liste für die "Unberührbaren" einzurichten, für ihn keinen Fortschritt, sondern die Spaltung der Hindus. Im September 1932 tritt er ein "episches Fasten" an – nicht nur gegen die Briten, sondern auch gegen die Parias selbst, deren Anführer eine eigene Liste als Errungenschaft feiert. Nach neun Tagen Hungerstreik finden die zerstrittenen Parteien einen Kompromiss: eine feste Anzahl von Sitzen für die "Unberührbaren" – aber keine getrennten Listen.
Aber die Fronten bleiben starr. Die Hindus, die einer Kaste angehören, nehmen Gandhi übel, dass sie nun weniger Sitze in den Parlamenten haben – und der Chef der "Unberührbaren" betrachtet den Mahatma jetzt als "Feind Nummer eins". Zur Klärung beschließt er, erneut für drei Wochen die Nahrung zu verweigern; nach der Tortur wiegt er nur noch 38 Kilogramm.
Auch politisch ist er erschöpft – und verlässt 1934 sogar die Kongresspartei, um fortan nur noch als spiritueller Führer zu wirken. Als politischen Erben baut er den 20 Jahre jüngeren Jawaharlal Nehru auf, der 1929 erstmals zum Vorsitzenden der Partei gewählt worden ist.
Wie Gandhi ist Nehru Jurist, wie er in England geschult: ein Brahmanensohn, der auch im schlichten Baumwollgewand der Kongresspartei noch eine elegante Figur macht. Doch so innig Nehru den Mahatma verehrt – mit dessen spirituellem Ehrgeiz kann er nicht viel anfangen.
Während Gandhi davon überzeugt ist, dass "niemand ohne Religion leben kann", flößt der Götterglaube als "Feind des klaren Denkens" Nehru nur "Grauen" ein. Und wo sich Gandhi in ein ländliches Idyll zurücksehnt, schwebt Nehru ein modernes, unabhängiges, demokratisches Indien mit sozialistischen Zügen vor.
Und inzwischen ist es auch nicht mehr Gandhis gewaltloser Widerstand, der Indiens Befreiungskampf beschleunigt. Sondern der Krieg.
Der Krieg hilft Gandhis Sache
Denn Deutschlands Überfall auf Europa 1939 setzt das Empire unter Zugzwang. Die USA, nach ihrem Kriegseintritt 1941 Großbritanniens wichtigster Verbündeter, pochen dringlich auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und zur Verstärkung ihrer Armeen in Europa, Nordafrika und Nahost, aber auch ihrer asiatischen Bastionen gegen die Achsenmacht Japan ist die Krone zudem auf die Kooperation ihrer indischen Untertanen angewiesen.
Die werden zunächst nicht gefragt. Mit Massenrekrutierungen blähen die Briten ihre indische Armee von 200.000 auf mehr als 1,8 Millionen Mann auf; mangels britischer Kräfte dienen Tausende Inder als Offiziere. Und auch indische Fabriken müssen jetzt mit erhöhter Schlagzahl, oft unter Einsatz von Zwangsarbeitern, für Londons Krieg produzieren.
Dennoch bietet die Kongresspartei den Kolonialherren ihre Unterstützung an, unter der Bedingung, dass Indien sofort eine eigene Regierung bekomme und bald darauf die völlige Freiheit –, ein Angebot, das die Kolonialmacht zurückweist.
Gandhi lehnt den Einsatz für Großbritanniens Krieg ohnehin ab: Er ist gegen jede bewaffnete Aktion – und rät sogar den deutschen Juden zum gewaltlosen Widerstand. Doch 1942 nehmen die Japaner Singapur ein, kreuzen japanische Schiffe vor der indischen Küste.
Jetzt steht der Feind schon fast auf dem Subkontinent. Sogar der erzkonservative britische Ministerpräsident Winston Churchill ("Ich hasse die Inder") beginnt nun, auch gedrängt vom US-Präsidenten Roosevelt, sich mit der Idee eines unabhängigen Indien anzufreunden. Drei Wochen nach der Invasion schickt er einen Mann seines Kriegskabinetts als Unterhändler nach Delhi.
Dessen Vorschläge treffen auf Ablehnung der Kongresspartei, der die Einheit Indiens am Herzen liegt. Denn die 565 Fürsten, die nur der Krone verpflichtet sind, sollen ein Gutteil ihrer Macht behalten. Und jedes Fürstentum soll selbst entscheiden, ob es in der Union bleibt. Doch das, befürchtet die Kongresspartei, könnte zu einer "Balkanisierung" des Landes führen.
Noch im gleichen Jahr startet die Partei eine Kampagne zum sofortigen Abzug der Briten. Damit ist deren Verhandlungsbereitschaft erschöpft. Der taumelnde Riese schlägt noch einmal mit aller Härte um sich. Hunderte indischer Politiker werden eingekerkert, darunter Nehru und Gandhi. Die Unruhen, die als Reaktion auf die Verhaftungswelle ausbrechen, unterdrückt das Kolonialregime mit äußerster Brutalität: Nach offiziellen Angaben sterben dabei 1000 Zivilisten – Gerüchten zufolge sind es 25.000.
Für die Briten wird das Regieren ihrer Kolonie immer schwieriger
Auch unter den Indern verschärfen sich jetzt die Konflikte: Die Muslime, die fast ein Drittel aller Einwohner stellen (und im Nordwesten und Nordosten sogar die Bevölkerungsmehrheit), fürchten, in einem unabhängigen Indien von der Hindu-Mehrheit diskriminiert zu werden.
Und so ist es nicht zuletzt dieser wachsende Glaubenshass, der London in Angst versetzt. Ungleich mehr als vor Gandhis Fasten und Salzmärschen fürchten die Briten sich vor einem Bürgerkrieg – vor der Aussicht, auf einem brennenden "Schiff mit Munition im Laderaum" in der Falle zu sitzen, wie es ein hoher Offizier ausdrückt.
Anführer der indischen Muslime ist der Rechtsanwalt Mohammad Ali Jinnah, ein hagerer Kettenraucher, der täglich 50 Zigaretten der Marke "Craven A" inhaliert, gern Shakespeare zitiert und der "New York Times" als "einer der bestgekleideten Männer im British Empire" gilt.
Jinnah ist kein Fundamentalist: Selten besucht er die Moschee, und auch einem Schinkensandwich oder einem Glas Whisky ist er nicht abgeneigt. Doch nun fordert er eine eigene Region, die sich zum ersten modernen islamischen Staat der Welt entwickeln soll – und zwar in den muslimisch dominierten Regionen Punjab, Briab, Afghan (eine Grenzprovinz zum heutigen Afghanistan), Kaschmir und Baluchistan. Nach deren Initialen und Endsilben soll sie "Pakistan" heißen. Wenig später fordert Jinnah, dass auch das im Osten gelegene Bengalen dem zukünftigen Staat zugeschlagen wird.
Um seine Ambitionen zu unterstreichen, ruft er für den 16. August 1946 zum Generalstreik auf. In Kalkutta, wo 20 Prozent Muslime einer großen Hindu-Mehrheit gegenüberstehen, wird dar aus ein Blutbad.
Vier Tage lang ziehen Mörderhorden beider Religionen durch die Straßen, töten, schlagen, zerhacken, verbrennen und vergewaltigen alle, die anderen Glaubens sind. Mancherorts stapeln sich die Leichen haushoch zwischen den aufgedunsenen und stinkenden Kadavern heiliger Kühe; Geier und Hunde machen sich über das Fleisch her. Mehr als 15 000 Menschen werden getötet.
Jetzt verschwendet Großbritanniens neuer Premier Clement Attlee keinen Gedanken mehr daran, Indien zu halten. Ohnehin zeigt seine sozialdemokratische Labour Party weniger Interesse am Erhalten des Empire als vorangegangene konservative Regierungen. Überdies hat sich die indische Armee zum immer schwerer erträglichen Kostenfaktor entwickelt. Und im Unterschied zu anderen Kolonien hat Indien weder unverzichtbare Rohstoffe noch eine einflussreiche britische Siedlerbevölkerung, auf die London Rücksicht nehmen müsste.
Auch anderswo bröckelt ja die koloniale Welt. 1945 kann Frankreich Aufstände in Algerien und Syrien nur noch mit blutiger Repression und Bombenangriffen niederschlagen. Und 1946 entlassen die USA die Philippinen in die Unabhängigkeit.
Bis 1949 werden die meisten Kolonien Süd- und Südostasiens dem Inselstaat in die Freiheit folgen. In den 1950er Jahren wird auch ein großer Teil Nordafrikas die Fremdherrschaft abstreifen. Und zwischen 1957 und 1965 wandelt sich die Mehrzahl der europäischen Besitzungen südlich der Sahara ebenfalls in selbstständige Staaten – 18 Territorien sind es allein im Jahr 1960.
Im Februar 1947 kündigt Attlee den Abschied der Briten von Indien bis zum Juni 1948 an. Jetzt geht es nur noch darum, mit heiler Haut aus dem Problemgebiet herauszukommen – und nach außen den Anschein konzilianter Stärke zu wahren.
Zur Abwicklung der britischen Herrschaft schickt Attlee einen neuen Vizekönig nach Neu-Delhi: Lord Louis Mountbatten, einen 47 Jahre alten, hochgewachsenen, kultivierten Aristokraten, Urenkel von Queen Victoria und Vetter des amtierenden Königs Georg VI. So selbstbewusst geht der Adelige ans Werk, dass er es wagt, von London völlige Entscheidungsfreiheit zu verlangen. Schon nach zwei Wochen Indien ist ihm klar, dass es riskant wäre, bis zum Juni 1948 zu warten. Das zerrissene Land biete, so sein erster Bericht, "ein Bild trostloser Düsternis". Er beschließt, nicht auf langwierige Konferenzen zu setzen, sondern sofort mit den Anführern des Freiheitskampfs jeweils unter vier Augen zu verhandeln.
Mit Nehru, so wie Mountbatten ein Gentleman aus altem Adel, ist er sich schnell einig: Unabhängigkeit für ein geeintes Indien, und zwar so bald wie möglich. Gandhi irritiert ihn mit dem zerbeulten Blechteller aus dem Gefängnis, den er mitgebracht hat, um während des Treffens daraus Ziegenmilch zu löffeln – und mit seinem salomonischen Vorschlag: Lieber das ganze Land der Muslimliga übergeben, als es zu zerreißen.
Weniger konziliant zeigt sich Mohammed Ali Jinnah. "Mit äußerster Kälte und dünkelhaftem Hochmut", so Mountbatten, trägt er seine Forderung vor: Unabhängigkeit sofort – aber nur in einem geteilten Indien.
Der einzige Kompromiss, den der Vizekönig aushandeln kann, ist, dass die Teile Punjabs und Bengalens, in denen mehrheitlich Hindus leben, bei Indien bleiben. Sein Plan eines geeinten Indiens aber ist nach seinen ersten drei Wochen im Land gescheitert.
Die Abtrennung sei ein "Wahnsinn", klagt Mountbatten. Doch der "unglaubliche Hass zwischen den Religionsgruppen" lasse ihm keine Wahl. Und die "chirurgische Operation", die Jinnah verlangt, ist auch administrativ eine Herausforderung: Neben dem Land müssen auch Staatsvermögen und -schulden aufgeteilt werden, Universitäten und Gefängnisse, Tintenfässer in Amtsstuben und eine ganze Armee.
Die gesamte Infrastruktur Bengalens und des Punjab muss zerstückelt werden, dazu zahllose gemischt bewohnte Städte und Dörfer – sowie die Gebiete der Sikhs, jener Religionsgemeinschaft, die muslimische und hinduistische Lehren vereint. Und das alles binnen weniger Wochen: Als Termin für die Unabhängigkeit hat Mountbatten, ohne viel zu überlegen, den 15. August 1947 bestimmt.
Hunderttausende sind auf der Flucht
Als der große Tag heranbricht, jener Tag, an dem die Kolonialherren nach 90 Jahren ihre Macht abgeben, sind Delhis Straßen geschmückt mit Bannern und frisch getünchten Wänden, mit Flaggen und elektrischen Lichterketten in den neuen Nationalfarben Orange, Weiß und Grün.
Restaurants servieren Unabhängigkeits-Menüs, Kinos zeigen gratis indische Filme, und bei den Herrenschneidern sind die traditionellen Sherwani-Übermäntel ausverkauft. Aus den Konditoreien ziehen Düfte nach gekochter Milch, Rosenwasser und Kardamom. Schwarzhändler machen kleine Vermögen mit (eigentlich rationiertem) Zucker.
Im strömenden Monsunregen hält Nehru eine Rede an sein jubelndes Volk. Und im Saal der Verfassung gebenden Versammlung dröhnen die Muschelhörner und läuten die Glocken die neue Ära ein.
Am nächsten Morgen wird Lord Mountbatten, tags zuvor noch Vizekönig, unter Fanfarenstößen zum neuen Generalgouverneur ernannt. Im Princes Park drängen sich Hunderttausende freie Inder, jubeln Nehru und Mountbatten zu. Mütter halten ihre Babys in die Höhe, damit sie im Gedränge nicht zerquetscht werden.
Unter Salutschüssen steigt die neue Trikolore am Fahnenmast empor, und wie bestellt erglüht am Himmel ein Regenbogen. Mit einem Schlag hat die britische Kolonialmacht 388 Millionen Untertanen verloren – das ist die Hälfte des Empire.
"Das größte Reich, das die Welt je gesehen hat, tat etwas, was nie zuvor ein Reich getan hatte", wird die britische Historikerin Alex von Tunzelmann schreiben: "Es gab auf. Das British Empire verfiel nicht, es fiel einfach; und es fiel stolz und majestätisch in sein eigenes Schwert."
Und die Historiker Jan C. Jansen und Jürgen Osterhammel werden vermuten, "dass die Briten spätestens 1946 von Treibenden zu Getriebenen wurden; am Ende hatten sie jeden Einfluss auf das Geschehen verloren".
Gandhi bleibt den Unabhängigkeitsfeiern fern. Er wolle lieber ein wenig fasten und spinnen, sagt er. Für ihn ist die Teilung Indiens eine "Vivisektion", eine "Sünde".
Es folgen Szenen einer Apokalypse
Und tatsächlich: Die Teilung des einstigen Britisch-Indien scheint die Gewalt erst anzufachen. Noch am Unabhängigkeitstag, Indien und Pakistan sind erst seit wenigen Stunden frei, rollt ein gespenstischer Eisenbahnzug mit Flüchtlingen aus dem pakistanischen Lahore im indischen Amritsar ein: In ihm liegen Hunderte tote Hindus und Sikhs mit eingeschlagenen Schädeln, herausgerissenen Eingeweiden, durchschnittenen Kehlen. An der Wand des letzten Waggons in weißer Tünche eine Botschaft der Killer: "Dieser Zug ist unser Unabhängigkeitsgeschenk für Nehru. "
Was in den Wochen darauf folgt, sind Szenen einer Apokalypse. Im Punjab gehen Nachbarn mit Keulen und Hockeyschlägern aufeinander los. Sikh- und Hindu-Banden erschlagen und kastrieren Muslime, rösten deren Babys am Spieß; Muslime schneiden Hindu-Frauen die Brüste ab.
In Lahore brennen die Viertel der Sikhs und Muslime, in Amritsar die Straßen, wo Hindus wohnen. Sikh-Horden schänden muslimische Frauen, jagen sie durch die Straßen und verbrennen sie bei lebendigem Leib. Polizei und Armee sind machtlos – oder lassen die Täter gewähren. Flüchtlingstrecks schieben sich Straßen und Bahndämme entlang, queren Felder, bedroht von Banden, die im hohen Korn auf sie lauern. Zu Hunderttausenden fliehen Hindus aus dem jetzt pakistanischen Lahore, wo zugleich 70 000 muslimische Exilanten vor der Verfolgung jenseits der Grenze Schutz suchen.
Wie viele Menschen nach der Teilung des Landes den Gewaltausbrüchen zum Opfer fallen, ist umstritten – die Schätzungen schwanken zwischen 200.000 und zwei Millionen Toten. Mehr als eine halbe Million Inder sind bis September 1947 auf der Flucht, wohl rund 100.000 Frauen werden entführt und brutal vergewaltigt.
Dass es ausgerechnet in Indiens größter Stadt Kalkutta, dem Schauplatz der Massaker von 1946, vorläufig friedlich bleibt, grenzt an ein Wunder. Und dieses Wunder ist offenbar das Verdienst des Mannes, der mit den politischen Querelen längst nichts mehr zu tun hat. Mahatma Gandhi.
"Warum tötet ihr mich nicht?", fragt er
Auf Bitten der muslimischen Gemeinde Kalkuttas, die in ihm ein Schutzschild gegen die Hindus erhofft, hat er sich zwei Tage vor dem Unabhängigkeitstermin im Elendsviertel Beliaghata niedergelassen – gemeinsam mit jenem Muslimführer, der im Jahr zuvor das Blutbad angestiftet hat.
Von dort aus predigt er zur Menge. Am Tag nach seinem Einzug kommen 10 000 Menschen, um ihn sprechen zu hören. Tags darauf sind es 30 000 und noch einen Tag später fast 100 000 Menschen.
Als eine halbe Million Zuhörer anrücken, verlegt er die Rede auf einen Sportplatz, und sein Publikum wächst auf eine Million. Und auf magische Weise macht das Morden um Kalkutta einen Bogen.
"Im Punjab haben wir 55 000 Soldaten und Unruhen in großem Maßstab", staunt Generalgouverneur Mountbatten. "In Bengalen besteht unser Aufgebot aus einem einzigen Mann, und es gibt keine Unruhe. "
Nach zwei Wochen aber bringen Flüchtlinge die Horrorgeschichten aus dem Punjab auch nach Kalkutta – und die Hindus der Stadt in Wallung.
Am 31. August stürmt eine wütende Meute Gandhis Unterkunft. Die Menschen tragen einen in Verbände gewickelten Hindu mit sich, angeblich Opfer eines muslimischen Messerangriffs, und fordern den Friedensmann auf, ihren Rachefeldzug anzuführen.
Gandhi aber steht ruhig vor den Angreifern, mit verschränkten Armen, und fordert sie auf, dann doch lieber ihn umzubringen: "Warum tötet ihr mich nicht?"
Einer der Eindringlinge wirft einen Ziegel, ein anderer schlägt mit einem Polizeiknüppel. Dann macht sich der Mob auf den Zug durch Kalkuttas Straßen – nur wenige Hundert Meter von Gandhis Quartier jagen Handgranaten einen Lastwagen mit fliehenden Muslimen in die Luft. Am folgenden Tag ziehen die Behörden Bilanz: rund 50 Tote und 300 Verletzte. Wieder greift Gandhi zu seinem erprobten Ritual – dem Fasten. Und tatsächlich bringt er Kalkutta für Monate erneut zur Ruhe.
So erfolgreich ist sein Opfer, dass er es in der Hauptstadt Delhi wiederholt. Dort sind im September 1947 nach einem Bombenanschlag auf muslimische Flüchtlinge bei Unruhen binnen zwei Tagen 450 Menschen ums Leben gekommen. Hindus überfallen muslimische Läden, setzen muslimische Pferdetaxis in Brand, zetteln Schlachten mit der Armee an. Geschätzt 600 000 Menschen taumeln im Blutrausch durch die Stadt. Die Situation ist "gleichbedeutend mit Krieg", wie Ministerpräsident Nehru im Radio erklärt.
In Delhi zelebriert der inzwischen 78-jährige Gandhi am 13. Januar 1948 seine letzte Zeremonie des Hungers – ohne jede Ankündigung und ohne einen Hinweis dar auf, welchem Zweck sie dient: nur dem Ende der Bluttaten in Delhi? Oder auch der Aussöhnung der zerstrittenen Regierung? Oder der Zahlung von 500 Millionen Rupien, die Indien dem abgespaltenen Pakistan laut Teilungsvertrag schuldet und noch immer zurückhält?
Reglos liegt der Mahatma auf seiner Pritsche im Haus eines Zeitungsverlegers. Er verfolgt die Kette der Reuigen, die an ihm vorbeiziehen, und das Palaver der Kabinettsmitglieder, die ihre Sitzung an sein Lager verlegt haben und vor seinen Ohren die Frage der Teilungsschulden be raten. Von draußen hört er auch den Hass der Enttäuschten und Wütenden, die ihn als Verräter an der Sache der Hindus sehen: "Lasst Gandhi sterben", rufen sie, "lasst Gandhi sterben. "
Nach fünf Tagen, am 18. Januar, geben die Vertreter der wichtigsten Hindu-Gruppen der Stadt das Versprechen ab, fortan Leben und Eigentum der Muslime zu schonen. Nehru ist es, der dem alten Mann das erlösende Glas Fruchtsaft reichen darf.
Doch die Gewalt, die Gandhi unter Einsatz seines Körpers scheinbar gebändigt hat, zielt jetzt immer direkter auf ebendiesen Leib. Am 20. Januar entkommt er auf einer seiner Gebetsversammlungen, bei denen er zum Verdruss der Fundamentalisten auch Verse aus dem Koran und der Bibel vorträgt, knapp dem Bombenattentat eines Hindu-Chauvinisten aus dem Punjab.
Mit Gandhis Opfer findet die Gewalt vorerst ein Ende
Zehn Tage später aber wird Gandhis Selbstopfer zur bitteren Realität. Um halb fünf Uhr nachmittags nimmt er an diesem 30. Januar 1948 im Garten seines Gastgebers ein Abendessen ein: ein wenig Ziegenmilch, etwas Gemüse, danach einen Pudding aus Ingwer, Zitrone und Aloensaft. Anschließend führen zwei seiner Großnichten den alten Mann durch die Kolonnaden zum Garten hinter dem Haus, wo schon an die 500 Menschen auf ihn warten.
Als er eintrifft, stehen die Anhänger auf. Ein besonders aufdringlicher Mann verbeugt sich vor dem Mahatma, presst die Handflächen zusammen und grüßt mit dem traditionellen namaste.
Eine der Nichten versucht, den Mann aus dem Weg zu schieben: Gandhi ist schon zehn Minuten zu spät. Da zieht der Fremde eine Pistole und feuert drei Schüsse auf den alten Mann ab. He rama, soll Gandhi in dem Moment geseufzt haben, "O Gott", bevor er zusammensinkt.
Der Attentäter, ein Hindu-Hardliner namens Nathuram Godse, wird festgenommen und am 15. November gehängt. Ein herbeigeeilter Arzt kann Gandhi nicht mehr helfen. Anhänger scharren Reliquien zusammen: blutgetränkte Erde, die sie mit den Händen aus dem Gartenboden schaufeln.
Doch tatsächlich findet die Gewalt, die Indien anderthalb Jahre lang zerrissen hat, mit Gandhis Opfer vorerst ein Ende: In den folgenden 50 Jahren flammt der Hass zwischen Indiens Volksgruppen nur noch sporadisch und in kleinem Maßstab auf (allerdings sind Indien und Pakistan bis heute – inzwischen nuklear gerüstete – Todfeinde). 2002 aber verheeren neue Pogrome gegen die muslimische Minderheit das Land, töten Hindus schätzungsweise 2000 Muslime und treiben rund 200 000 in die Flucht – ausgerechnet in Gandhis Heimatstaat Gujarat.
Welchen Anteil der Mahatma an Indiens Freiheitskampf tatsächlich hat, ist unter Historikern heftig umstritten. Hätten seine spirituellen Utopien nicht die Unabhängigkeitsbewegung gespalten, dann wären die Briten womöglich schon in den 1920er Jahren gezwungen gewesen, den Subkontinent zu verlassen – so spekuliert beispielsweise die englische Geschichtswissenschaftlerin Alex von Tunzelmann.
Doch Gandhis Mut und Unbeirrbarkeit, seine Moral, seine Kompromisslosigkeit und seine geradezu tollkühne Wahrheitsliebe sind es, die den Prozess begleitet haben wie ein Gebet.
Sein Beispiel hat Millionen gezeigt, dass die Dinge nicht so sein müssen, wie sie sind. Und dass dafür jeder Einzelne allein verantwortlich ist.