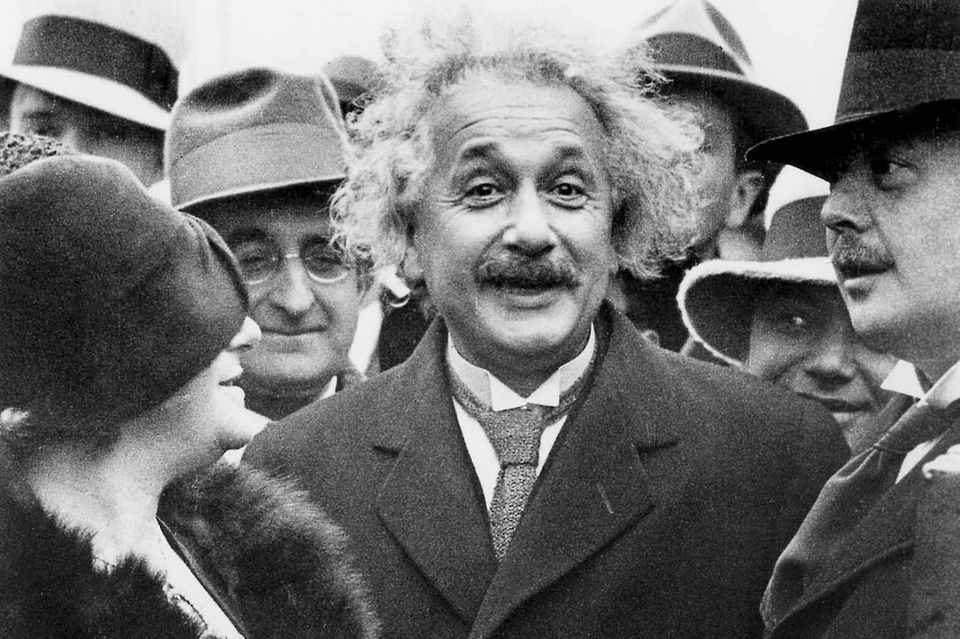Das Wort "historisch" sollte sparsam gebraucht werden - erst recht im Kontext der EU, deren stets letzte und entscheidende Rettungsgipfel sich fast unzählbar aneinanderreihen. Was ihre Fischereikommissarin Marina Damanaki allerdings im Juli 2011 auf den Tisch legte, ist geschichtsträchtig. Zumindest für die 1983 eingeführte Gemeinsame Fischereipolitik. Die Reformvorschläge der Griechin sind mutig, werden von Umweltverbänden wie Wissenschaftlern gelobt. Denn noch nie gab es in den vergangenen 30 Jahren die Chance, die Geschwüre des schwer erkranken Fischereimanagements mit einer Operation zu entfernen. "Wir müssen handeln, um alle Fischbestände wieder in einen gesunden Zustand zu versetzen", sagte Damanaki, als sie ihre Ideen präsentierte. "Damit sie für heutige und zukünftige Generationen erhalten bleiben."
Rechtlich haben sich die EU-Staaten längst verpflichtet, ihre Bestände zu schonen: In der EU-Meeresrahmenrichtlinie. Und 2002 auf dem Weltgipfel in Johannesburg, wo sie sich verpflichteten, bis 2015 nur noch nachhaltig zu fischen, also nach dem wissenschaftlichen Kriterium des maximalen Dauerertrages.
Soweit die Theorie. In der Praxis sind heute 47 Prozent der EU-Bestände überfischt; im Mittelmeer sind es über 80 Prozent – bezogen auf die bekannten Populationen. Die Dunkelziffer dürfte noch höher liegen. Die Kabeljau-Population im Nordostatlantik ist laut WWF in den letzten 40 Jahren 90 Prozent geschrumpft. Und große Arten wie der Rote Thunfisch und zahlreiche Haie sind in vielen früheren Revieren ganz verschwunden. Aktuell sind die Bestände von Arten wie Aal, Heilbutt, Nordsee-Kabeljau, Rotbarsch, Steinbeißer, Seehecht und Dorade besonders angegriffen. Darum raten Umweltorganisationen in ihren Fisch-Einkaufsführern vom Kauf ab. Und Fischereibiologen fordern mehrjährige Managementpläne – ein Instrument, das Marina Damanaki auch vorgeschlagen hat.
Selbstverschuldete Misere und gigantische Verschwendung
Die EU hat ihre Fischereimisere jahrzehntelang selbst gefördert – mit zu hohen Fanquoten, fehlenden Schutzgebieten und Subventionen für die ohnehin zu große Flotte. "Die EU-Staaten sind traditionell Freunde der Fischer, nicht der Fische", sagt Fischereibiologe Rainer Froese vom Kieler Geomar-Institut. Das will die Kommissarin nun ändern: Die Fördergelder sollen teils auslaufen, die EU-Flotte deutlich kleiner werden. Und der Beifang soll ab 2014 zwingend an Land gebracht werden und nicht mehr, wie von der EU vorgeschrieben, über Bord gehen. Es geht um alle Meerestiere, die zu klein sind oder als unverwertbar gelten. Auch wenn die Fanglizenz für eine Art fehlt, die zufällig im Netz landet, werfen Fischer die - oft marktfähige - Beute zurück ins Meer. Wobei sie fast immer stirbt.
Umweltverbände kritisieren diese gigantische Verschwendung scharf, die geschätzte 23 Prozent aller EU-Fänge ausmacht. Es geht auch anders: Norwegen schreibt seit 1987 vor, den Beifang anzulanden. Und ahndet Verstöße mit drastischen Strafen. Das hat drei praktische Vorteile: Die Fischer beginnen von sich aus, den Beifang zu vermeiden und gezielter zu fischen – mit neuen Netzen oder in anderen Seegebieten. Biologen können zudem die Bestände besser schätzen, weil sie Daten über die gesamten Fänge haben und nicht nur, wie in der EU, über einen kleine Ausschnitt. Und kulinarisch uninteressante Fische können zu Fischmehl verarbeitet werden, das in der Aquakultur verfüttert wird. Und dann nicht von wilden Sardellen oder Makrelen stammt, die extra dafür gefangen werden müssen.
Doch der Beifang ist nur eines der Probleme. Forscher und Umweltverbände kritisieren seit Jahren auch die Vergabe der Fangmengen, der Quoten. "Wir brauchen dringend mehr Wissenschaftlichkeit im Prozess", sagt Fischereibiologe Rainer Froese. Während die erlaubten Fangmengen in Ländern wie den USA, Australien und Neuseeland gesetzlich an die Empfehlungen der Wissenschaft gebunden sind, unterhält die EU einen faktisch regelfreien Fischereibasar: Ihre Fischereiminister legen am Ende jeden Jahres die Fangquoten für jeden Mitgliedstaat fest, nach Fischart und getrennt für Ostsee, Nordsee und Nordatlantik. Minister der eher "fischfreundlichen" Staaten wie etwa Deutschland, Finnland oder Österreich stehen dabei der Gruppe der "fischereifreundlichen" Länder gegenüber, zu denen traditionell die Mittelmeer-Länder gehören. Eigentlich ist die Wissenschaft Teil des Prozesses: Ein Forschergremium – der ICES für den Nordostatlantik – schlägt der EU-Kommission Fangmengen vor. Daraus wird eine Vorlage für die Fischereiminister, die dann verhandeln und oft über die wissenschaftlichen Vorschläge hinausgehen – um 68 Prozent im Schnitt, wie eine Studie für die Jahre 1987 bis 2011 zeigt. Damanaki will das Geschacher nun wissenschaftlichem Sachverstand unterwerfen - und die Quoten für mehrere Jahre festlegen.
Aufgeblähte Flotte und verfehlte Prämien
Ein weiteres Problem sind die Subventionen, genauer: der Fischereifonds (EFF), mit dessen Geldern Europas Fischer über die Jahrzehnte eine Flotte aufgebaut haben, die – je nach Studie – 30 bis 40 Prozent über der Größe liegt, die den Beständen angemessen wäre. Dabei ist die reine Zahl der Boote ist gar nicht das Problem: 80 Prozent der 83.000 Schiffe sind kleiner als zwölf Meter, fallen also in die "kleine und handwerkliche" Fischerei. Auch diese Boote tragen zwar zur Überfischung bei, der Hauptfaktor aber sind die großen Trawler, die auf hoher See unterwegs sind. Mit immer besseren Maschinen, größeren Netzen, moderneren Navigationsgeräten, effizienterem Echolot. In solche Technik haben die großen Fischereiunternehmen investiert – mit Hilfe der EU-Gelder. Und auch mit Hilfe der "Abwrackprämien", mit denen die Flotte eigentlich gezielt verkleinert werden soll – und die Damanaki 2013 auslaufen lassen will.
Seit 1994 hat die EU Verschrottungen mit 2,7 Milliarden Euro gefördert. Ergebnis: Die schiere Zahl der Boote ist zwar gesunken. Aber die Fangkapazität der EU-Schiffe ist durch die technischen Verbesserungen gestiegen. Die Abwrackprämien haben, und das sagt die Kommission selbst, als politisches Steuerungsinstrument versagt.
Gegen Damanakis Plan, sie abzuschaffen, gibt es unerwartet großen Widerstand. Vor allem im EU-Parlament, das die Reform derzeit berät – zum ersten Mal, da ihm der Vertrag von Lissabon neue Mitspracherechte für die Agrar- und Fischereipolitik gegeben hat. Voraussichtlich entscheidet das Parlament im Februar oder März über die Reform. Bestenfalls, so heißt es in Brüssel, ist dann im Herbst eine Einigung mit dem Ministerrat da. Die Reform würde dann zum Januar 2014 in Kraft treten. Derzeit gibt es vor allem französischen Gegenwind: Der Abgeordnete Alain Cadec, bekannt für seine Nähe zur Fischereiindustrie, hat im EU-Parlament einen Gesetzesentwurf für die Neufassung des Förderfonds vorgelegt, der vielen die Sprache verschlagen hat. Demnach sollen nicht nur die Prämien fortgeführt werden, sondern alte, bereits abgeschaffte Subventionen wieder eingeführt werden. Die EU-Minister spielen das Spiel zum Teil mit: Sie haben im Oktober – ohne eigentlich an der Reihe zu sein – durchblicken lassen, dass sie viele Subventionen bis 2017 weiterführen wollen. "Die Entscheidung der EU-Fischereiminister ist ein totaler Fehlschlag", kritisiert etwa Karoline Schacht, Fischerei-Expertin des WWF.
Damanakis Ideen werden ausgebremst, einmal mehr in der Geschichte der EU-Fischereipolitik, die alle zehn Jahre reformiert wird. 2003 scheiterte schon der Malteser Joe Borg mit einem großangelegten Rettungsversuch – auch im Interesse der kleineren Fischer, deren Verbände vehement ökologische Reformen fordern, weil ihre Einkommen sinken und das Produkt schwindet. Draußen auf hoher See verdient der Sektor, an dem europaweit 400.000 Arbeitsplätze hängen, noch Geld - doch auch diese Einnahmen sinken.
Ob der große Wurf jetzt gelingt – es scheint immer fraglicher. Denn die Bremser, angefangen bei Frankreichs Fischereiminister Frédéric Cuvillier bis zum Cheflobbyisten Javier Garat, dem Vorsitzenden des Fischereiverbandes Europêche, haben Erfahrung - und Verbindungen. So viel, dass die Minister schon im Sommer das geplante Beifangverbot entkräften konnten; 2018 statt 2014 soll es kommen - teilweise. Damanakis Ziel, alle Bestände bis 2015 nach dem Prinzip des maximalen Dauerertrages zu befischen, wollen die Minister auf 2020 verschieben und nicht für alle Arten einführen. "Vieles, was in letzter Zeit vom Rat kommt, ist nicht sehr hilfreich. Es erschwert das ohnehin Schwierige", sagt SPD-Frau Ulrike Rodust, die im Fischereiausschuss des EU-Parlamentes mit der Reform betraut ist. Und dort 2600 Änderungsanträge zusammenfassen muss.
Die Uhr tickt
EU-Abgeordnete wie Alain Cadec, der Ire Pat Gallagher oder Carmen Fraga, die spanische Grande Dame der Szene, sind auch für mehr Nachhaltigkeit, sie taucht in ihren Presseerklärungen immer wieder auf. Es ist nur eine andere als die von Damanaki, die "über die NGO regiert", wie Fraga sagt. Die fischereinahen Abgeordneten verweisen – genau wie die Industrieverbände – auch gerne darauf, dass schon einiges erreicht worden sei: 53 Prozent der Bestände im Nordostatlantik würden schon nachhaltig befischt, das Bewusstsein in der Branche wachse und dadurch seien große Erfolge möglich - wie das "Dorschwunder" in der Ostsee oder die wiedererstarkte Nordseescholle.
Der erbitterte Widerstand gegen offenkundig vernünftige Ideen hat eine starke historische und kulturelle Dimension: Denn bei der Fischerei geht es um eine Jahrtausende alte Tradition. Und in den Mittelmeer-Ländern um ein Stück nationaler Identität, einen Berufsstand, der das Küstenbild prägt – und damit das Bild des Landes selbst. Und es geht um spezielle Sensibilitäten, sagt Ulrike Rodust. "Viele Fischer, die seit ihrer Jugend auf See sind, sehen sich auch in einem natürlichen Konflikt mit den Wissenschaftlern, die ihnen mit ihren Studien den Beruf verändern wollen ", erklärt die SPD-Frau. "Auch deshalb sind die Widerstände manchmal so massiv".
Lösungen liegen in weiter Ferne
Es gibt Analysen wie das EU-Forschungsprojekt Cevis, die zeigen, wo Fische besser "gemanagt" werden: Neben den USA und Kanada werden immer wieder Neuseeland und Australien genannt, weil Fischer dort ihre Quoten selbst besitzen und handeln. Sie haben Eigentum, das sie pflegen und mitunter auch vererben. Ein Vorteil gegenüber dem EU-System, in dem das Fangrecht an der Gemeinressource Fisch vom Staat vergeben wird, weshalb das direkte Verantwortungsgefühl des Fischers gegenüber dem Fisch kleiner ist als im Handelssystem. Der freie Quoten-Handel führt dazu, dass nur wirtschaftlich gesunde Fischereibetriebe überleben. Soweit die Theorie eines Systems, das Kommissarin Damanaki auch favorisiert; allerdings nicht für die ganze EU sondern nur für einzelne Länder. Doch wie kann verhindert werden, dass große Firmen die Quoten aufkaufen und es zu einer massiven Konzentration kommt? Und dabei die kleine Küstenfischerei stirbt? Es gibt die Konzentrationsprozesse, etwa in Neuseeland. Gleichzeitig scheinen dort die Bestände aber auch in besserem Zustand zu sein. Das Thema bleibt aber also umstritten.
Weitgehend unumstritten ist, wen viele als großes Vorbild sehen: Norwegen. Das Land hat auch Quoten eingeführt – und ist zufrieden damit. Ebenso wie mit der Entscheidung, Subventionen größtenteils abzuschaffen. "Unsere Flotte ist jetzt rentabel", sagte Fischereiministerin Lisbeth Berg-Hansen der FAZ. In Norwegen, sagen Europabeamte, sei eine ganz andere Kultur entstanden, eine der Kooperation und Ehrlichkeit. Fischer rufen von sich aus die Behörden an, wenn sie plötzlich in einem Gebiet nur noch kleine Exemplare fangen. Dann schließt die Küstenwache die Zone. Ein weiterer Grund dafür, dass es den norwegischen Beständen besser geht als den EU-Populationen, deren Zukunft gerade in einem politischen Spiel ausgehandelt wird. Sein Ausgang könnte historisch sein.