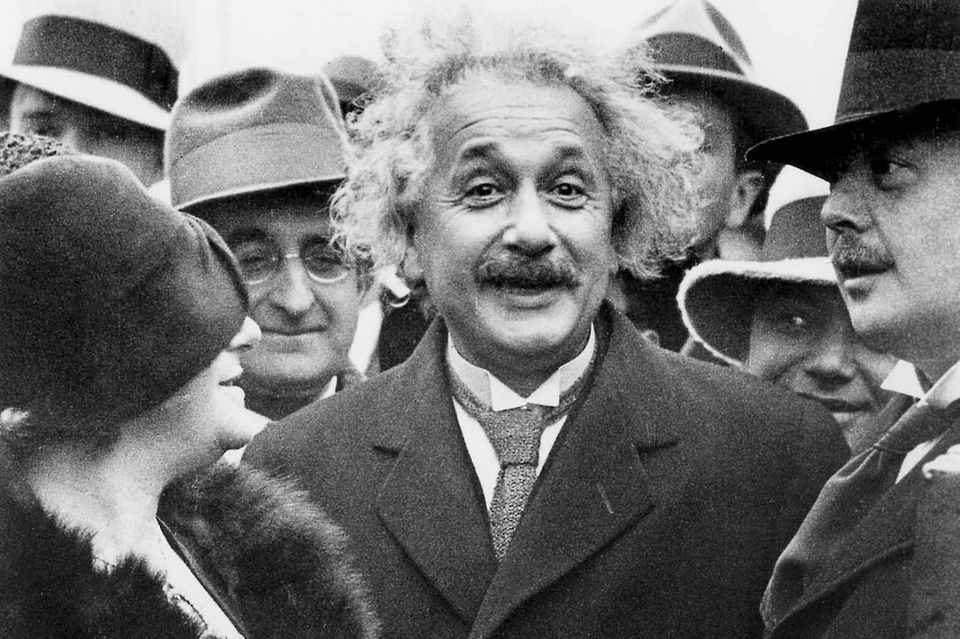Wenn Schimpansen im Zoo Sex haben, so der Primatologe Frans de Waal, „wenden sich viele Besucher schockiert ab und ziehen ihre Kinder vom Gehege weg“. Manche Affenmännchen setzen sich vor der Kopulation aufrecht hin, spreizen die Beine und stellen ihren erigierten Penis zur Schau. Die Genitalien paarungsbereiter Weibchen färben sich rosa und schwellen derart an, dass sie bis zu einem Viertel an Gewicht zunehmen.
„Besucher finden die Hinterteile abstoßend“, sagt de Waal. Besonders dann, wenn sich paarungsbereite Weibchen triumphierend auf den Kopf stellen, sodass ihre Genitalien noch mehr auffallen.
Die Scham unterscheidet den Menschen von anderen Lebewesen
Seit sich die Entwicklungswege von Schimpanse und Mensch vor rund sieben Millionen Jahren getrennt haben, hat der Mensch offenbar ein Gefühl entwickelt, das wohl allen anderen Lebewesen auf der Erde fehlt: die Scham. Wenn wir uns vor Fremden ausziehen, beschleunigt sich der Puls, und wohl niemand würde unbefangen nackt zur Arbeit, auf die Straße oder in den Supermarkt gehen.
Sobald Menschen in die Öffentlichkeit treten, schiebt sich die Scham zwischen Geist und Körper. Und doch wurde die sonderbare Regung unter Forschern lange vernachlässigt. Erst seit rund 15 Jahren fragen sich Wissenschaftler, welchen Vorteil die Entwicklung der Scham unseren Vorfahren brachte. Und ob etwa die Nacktscham tatsächlich in allen Kulturen vorkommt. Immerhin leben ja viele indigene Völker bis heute nackt.
Verhaltensforscher vermuten, dass Menschen im Gegensatz zu Tieren seit mehreren Hunderttausend Jahren keinen öffentlichen Geschlechtsverkehr mehr betreiben. Für gewöhnlich ziehen sie sich zum Sex zurück. Wissenschaftlern ist jedenfalls keine Gesellschaft ohne Genitalscham bekannt.
Zwar erscheinen manche Naturvölker sehr freizügig. Etwa die südamerikanischen Yanomami: Die Frauen tragen lediglich eine dünne Schnur um die Leibesmitte. Fordert man sie aber auf, die abzunehmen, reagieren sie ebenso verlegen wie die meisten europäischen Frauen, wenn sie sich vor Fremden entblößen müssten. Yanomami-Männer binden ihren Penis an der Vorhaut hoch. Doch auch sie genieren sich, wenn das Band herunterrutscht.
Völlig nackt, aber ebenso wenig schambefreit, leben die Kwoma in Neuguinea: Sie pflegen strenge Blick-Tabus. Männer dürfen Frauen nicht auf den Genitalbereich oder die Brüste schauen. Begegnen sich Mann und Frau, etwa auf einem Pfad, unterhalten sie sich Rücken an Rücken.
Freizügigkeit ist nicht unbedingt eine Frage der Erziehung
Selbst Anhänger der Freien Körperkultur blicken einander vornehmlich in die Augen. Über Sex zu sprechen ist in den meisten Nudistencamps tabu. „Menschliche Körperscham scheint nicht kulturspezifisch zu sein“, schreibt der Heidelberger Ethnologe Hans Peter Duerr in seinem fünfbändigen Werk über den „Mythos vom Zivilisationsprozess“. Sie sei vielmehr charakteristisch für die menschliche Lebensform überhaupt.
Zumindest ab einem gewissen Alter: Kinder haben meist kein Problem damit, sich nackt zu zeigen. Oft müssen sie von Erwachsenen aufgefordert werden, sich Kleidung überzuziehen. Erst im Grundschulalter wandelt sich der Blick. FKK-Anhänger stellen dann bei ihren Sprösslingen Prüderie fest: Der Nachwuchs verhüllt plötzlich sogar im Nudistenmilieu die Genitalien.
Eine ähnliche Erfahrung machten Angehörige eines israelischen Kibbuz, die ihre Kinder zum schamfreien Umgang mit dem anderen Geschlecht erziehen wollten: Die Jungen und Mädchen rebellierten so lange gegen die gemeinsame Nutzung der Schlafräume, Duschen und -Toiletten, bis die Kibbuzautoritäten nachgaben.
Dass sich Scham auch gegen erzieherischen Druck entwickelt, sieht der renommierte Verhaltensforscher Irenäus Eibl-Eibesfeldt als Indiz für eine stammesgeschichtliche Anpassung. Er geht davon aus, dass sich im Verlauf von Jahrmillionen im Erbgut unserer Vorfahren ein Komplex von Genen festsetzte, der Schamverhalten begünstigte. Diese Erbanlagen steuerten womöglich bestimmte Prozesse im Gehirn, die jene eigentümliche Gefühlsregung hervorriefen.
Eine „Ur-Scham“, die sich später weiterentwickelte. Noch heute lässt sich bei unseren nächsten Verwandten, den Schimpansen, erahnen, wie eine Vorform des menschlichen Schamempfindens ausgesehen haben mag: Rangniedrige Affen ziehen sich mitunter zum Geschlechtsverkehr zurück. Andernfalls kann es sein, dass sie von Ranghöheren mitten im Akt gestört und verjagt werden.
Wenn sich schwächere Männchen einem paarungsbereiten Weibchen nähern und bemerken, dass sie von einem mächtigeren Männchen beobachtet werden, reagieren sie zudem mit einer Beschwichtigungsgeste: Sie wenden den Blick ab, schauen zu Boden und verziehen ihr Gesicht zum „full closed grin“, einer dem menschlichen Lächeln vergleichbaren Äußerung der Verlegenheit.
Sofort erkennen die ranghöheren Schimpansen das Signal – und lassen von einem Angriff ab. „Vermutlich hat der Wunsch nach Abgeschiedenheit auch bei uns mit sexuellem Wettbewerb zu tun“, sagt Frans de Waal.
Ohne das Schamgefühl würden Menschen pausenlos an Sex denken
So ließe sich evolutionsbiologisch erklären, weshalb sich die Ur-Scham im Laufe der Menschwerdung weiterentwickelt hat: Das Verbergen des Geschlechtsverkehrs und der Genitalien gewährleiste ein ungestörtes Zusammenleben, meint Eibl-Eibesfeldt. Und das war vorteilhaft für ein Wesen, dem die Gruppe, das soziale Miteinander, als Lebensversicherung diente. Das schamhafte Verhalten verhinderte ständige Rivalitätskämpfe unter den frühen Hominiden.
Zudem könnte der Sex im Verborgenen vor Gefahren bewahrt haben. „Während des Aktes ist der Mensch so an seinen Partner hingegeben, dass er die Umwelt nicht mehr klar wahrnimmt und daher verwundbar ist“, sagt Eibl-Eibesfeldt. Wenn er ständig entblößte Geschlechtsorgane sähe, würde das unentwegt Begierden wecken. Und die wiederum würden den Menschen von anderer Beschäftigung ablenken.
Hat also erst die Scham den Zivilisationsprozess möglich gemacht? Der Tübinger Evolutionsbiologe Thomas Junker jedenfalls meint, dass sich kulturelle Errungenschaften wie Ackerbau, Viehzucht, Städtebau und Wissenschaft auch deshalb entwickelten, weil der Mensch – ohne sexuelle Ablenkung – die notwendige Zeit und Konzentration dafür aufbringen konnte.
Erstaunlicherweise bezieht sich die Körperscham, zumindest bei Frauen, nicht nur auf die Genitalien, sondern auch auf die Brüste. Der britische Zoologe Desmond Morris führt das auf den aufrechten Gang zurück: Frühe Hominiden seien noch – wie Schimpansen – auf das Gesäß der Weibchen fixiert gewesen. Als unsere Ahnen begannen, auf zwei Beinen zu schreiten, könnten sich die sexuell anregenden Körperzonen auf die Vorderseite verlagert haben.
Hominiden-Frauen mit fülligeren Brüsten, die männliche Partner an ein Gesäß erinnerten, waren möglicherweise besonders begehrt und konnten das neue Merkmal vererben. Indem die Brüste zum sexuellen Signal wurden, verlegte sich das Schamgefühl auch auf sie.
Da Menschen aller Völker die Nacktscham kennen, gehen Forscher davon aus, dass sie zu den Wesensmerkmalen des Homo sapiens gehört und der Mensch sich seit mindestens 100 000 Jahren die Genitalien bedeckt. Zunächst vermutlich mit Pflanzen, dann mit Leder, später mit Textilien. Die Kleidung gab den Menschen auch die Möglichkeit, ihre Ausstrahlung zu steuern.
Die langen weiten Kutten mittelalterlicher Nonnen und Mönche etwa entkörperlichten den Menschen, machten ihn geschlechtslos. Ganz anders in der frühen Neuzeit ab etwa dem 15. Jahrhundert, als diesseitige Freuden nicht mehr völlig tabuisiert wurden: Modebewusste europäische Männer trugen riesige Schamkapseln, die ihren Penis hervorhoben und den Eindruck einer ständigen Erektion weckten. In der Frauenkleidung traten nach und nach die weiblichen Rundungen vermehrt hervor.
Das Geschäft mit der Nacktheit setzt Scham voraus
Und seit den 1970er Jahren „erleben wir öffentliche Nacktheit als Alltäglichkeit“, so der Philosoph Michael Raub. Werbung, Filme, Massenmedien zelebrieren das Spiel mit der Blöße. Allenthalben präsentieren Menschen Haut, werden Milliardenbeträge mit der Freizügigkeit umgesetzt. Das aber bedeute keineswegs, dass wir in einer schambefreiten Gesellschaft lebten, vermerkt Raub. Denn das Geschäft mit den sexuellen Reizen setze nicht etwa Schamlosigkeit voraus. Sondern die Scham selbst.
Gaben sich Schimpansen noch mit einem Blick auf die Genitalien ihrer Artgenossen zufrieden, richtete Homo sapiens seinen Fokus auch auf ganz andere Körperbereiche. „Da der Mensch seine Geschlechtsteile bedeckte, sexualisierte sich im Verlauf der Evolution sein gesamter Körper“, sagt Thomas Junker.
Das Spiel mit der Blöße funktioniert also nur, weil Menschen schon die zarte Haut eines Ohrläppchens, die weiche Rundung eines Knies als erotisch empfinden können. Strahlende Augen, volle Lippen, wohlgeformte Glieder wurden für die Partnerwahl entscheidend und damit zum Selektionsfaktor.
So sehr auch die Scham vom Leib abzulenken scheint: Womöglich hat sie erst die Schönheit des menschlichen Körpers hervorgebracht.